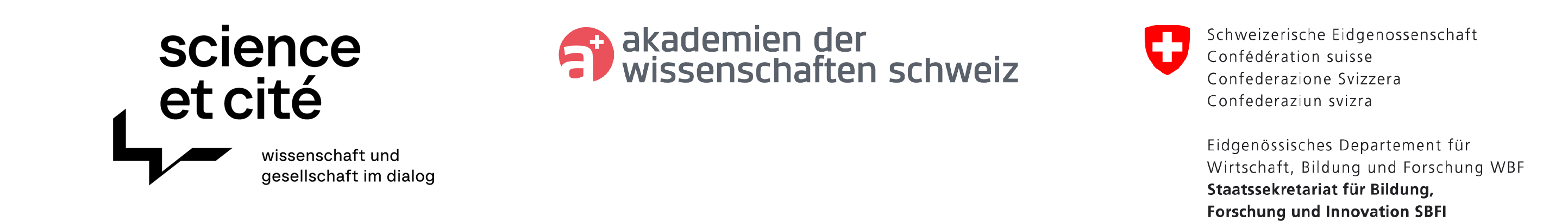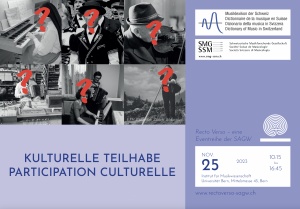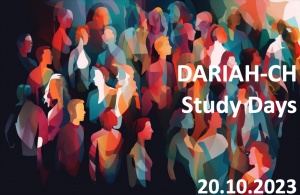Nikola Stosic
Citizen Science für Nachhaltige Entwicklung
| Christelle Ganne-Chédeville, co-Leiterin Nachhaltige Entwicklung an der BFH. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |  |
Citizen Science mobilisiert Bürger:innen und ermöglicht deren Teilnahme und Teilhabe an Forschungsprojekten. Doch wie können Forschungsinstitutionen ihre kreativen Köpfe besser dazu ermutigen, diese Methode zu nutzen? Insbesondere wenn es um gesellschaftliche Herausforderungen wie die Erreichung der Sustainable Development Goals (SDGs) geht? In Bezug auf Forschung für Nachhaltige Entwicklung ist die Einbindung von Citizen Science sinnvoll. Die Berner Fachhochschule (BFH) hat in ihrer Strategie «Inmitten der Gesellschaft» für den Zeitraum 2023-2026 sowie mit der Gründung des strategisches Themenfeld Nachhaltige Entwicklung Citizen Science als einen Schwerpunkt definiert.
Anschubfinanzierungen für Citizen Science an der BFH
Mit diesem Ziel initiierte das strategische Themenfeld Nachhaltige Entwicklung einen internen Aufruf im Rahmen ihres Förderprogramms im Februar 2024 für Citizen Science im Bereich Nachhaltige Entwicklung. Dadurch erhalten interdisziplinäre Forschungsteams der BFH Anschubfinanzierung für die Vorbereitung umfangreicherer, partizipativer Projekte mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Pro Projekt werden bis zu 40.000 CHF vergeben. Nach Abschluss des Aufrufs im April 2024 sollen die ersten Initiativen in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 starten können.
Köpfe zusammenstecken und entwerfen
Am 6. Februar veranstalteten die beiden BFH-Einheiten, das strategische Themenfeld Nachhaltige Entwicklung und die Forschungskommission, einen Workshop an der BFH, um interdisziplinäre Teams zu bilden und potenzielle Projektideen zu skizzieren. Tiina Stämpfli und Nikola Stosic von Science et Cité unterstützten die Veranstaltung mit wertvollen Inputs zur Konzeption und Evaluation von Projekten sowie mit Einblicken in ihre Arbeit zum Beitrag von Citizen Science für die SDGs. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre Ideen kurz vorzustellen und in Gruppenarbeit potenzielle Partner zu finden.
Fragen und Erkenntnisse
Bei diesem Workshop standen wichtige Fragen im Mittelpunkt: Wann soll Citizen Science im Projektverlauf integriert werden? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus? Inwiefern wird der Dialog mit der Gesellschaft durch das Projekt gefördert? Wie kann ein solches Projekt erfolgreich sein?
Unabhängig davon, ob es um kulturelle Untersuchungen, fürsorgliche Gemeinschaften, Herausforderungen in der Siedlungsentwicklung, Einrichtungen für straffällige Jugendliche, den Beitrag von KI für den Innenraumkomfort oder um Themen wie Verzicht und Suffizienz ging, diskutierten die Gruppen über den Grad der Beteiligung, die angemessene Anzahl von Iterationen im Citizen-Science-Prozess, die Bedeutung der Offenheit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die Anerkennung sowie die Vermeidung möglicher Konflikte im Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Als Ergebnis konnten folgende wichtige Erkenntnisse gewonnen werden:
- Citizen Science sollte bereits in sehr frühen Projektphasen berücksichtigt werden, sogar vor der Anschubfinanzierung, um sicherzustellen, dass sie erfolgreich umgesetzt werden kann.
- Citizen Science zeigt viel Potenzial. In der Bevölkerung besteht Motivation, an solchen Projekten mitzuarbeiten. Anreize helfen dabei, finanzielle Hürden abzubauen.
- Wissenschaft muss derzeit besser in der Gesellschaft bewertet werden. Wenn Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, tragen sie das Thema in die Gesellschaft und fördern dadurch das allgemeine Verständnis für die Forschung.
Du hast noch Fragen? Kontaktiere das Team Nachhaltige Entwicklung der BFH.
Erstellt am 20. März 2024
Museen als Orte des gemeinsamen Forschens
Museen fungieren als Bindeglieder zwischen Forschung und Zivilgesellschaft. Sie stellen mögliche Räume für Citizen Science bereit und schaffen damit innovative Möglichkeiten des gemeinsamen Experimentierens und Lernens. So ermöglichen sie eine enge Verbindung zu den Bürger:innen.
| Nikola Stosic ist Projektleiter im Bereich Citizen Science bei Science et Cité. |  |
Beim Workshop «Museen und Bevölkerung forschen gemeinsam», organisiert vom Verband der Museen der Schweiz und moderiert von catta, wurden den Teilnehmenden die Eigenarten und der Ablauf eines Citizen-Science-Projektes nähergebracht. Die Grundlage für den Workshop bildet die Ende 2023 veröffentlichte VMS-Broschüre zum Thema, bei der wir beratend involviert waren.
Anhand verschiedener Übungen wurden drei potenzielle Projekte herausgearbeitet, bei denen Museen einerseits als Orte, andererseits als Akteure von Citizen Science fungieren. Dabei war eine wichtige Erkenntnis, dass die Museen nicht in einem Vakuum existieren, sondern sich in einem Akteursnetzwerk einreihen, in dem unterschiedliche Stakeholder zum Gelingen eines Citizen-Science-Projekts beitragen:
Ein Citizen-Science-Projekt beginnt mit einer klaren wissenschaftlichen Forschungsfrage. Zu beachten sind aber auch andere zentrale Fragen für den spezifischen Ablauf von Citizen Science:
- Macht die Methode Citizen Science (überhaupt) Sinn?
- Wen brauchen wir? (Team und Rollen)
- Wie machen wir das? (Methoden)
- Wie finde ich Teilnehmende? Muss ich sie ausbilden? Wie bilde ich sie aus?
- Wie werden Daten erhoben und ausgewertet? Wie werden die Resultate geteilt?
- Wie läuft die Evaluation ab und wer ist beteiligt?
- Und nicht zuletzt, wie wird die Zusammenarbeit gefeiert?
Um diese und weitere Fragen bei der Projektkonzeption zu klären, wurde eine Orientierungshilfe für Citizen Science im Museum konzipiert. Der Routenplaner für Citizen Science im Museum wurde in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und catta entwickelt, wobei die Geschäftsstelle Citizen Science Schweiz beratend zur Seite stand. Übrigens 2022 haben wir gemeinsam mit Partner:innen und der Community die 10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien erarbeitet, anhand derer bei der Konzeption eines Projekts alle wichtigen Aspekte reflektiert werden können. Demnächst veröffentlichen wir dazu eine einfache Checkliste.
«Das gemeinsame Forschen macht das Museum nahbarer und stärkt das Vertrauen und die Bindung zum Museum.» Citizen Science in und mit Museen ist eine Methode, bei der Menschen ohne wissenschaftliche Ausbildung in Forschungsprojekte einbezogen werden können. Citizen-Science-Projekte nutzen die Kraft der Gemeinschaft, um neue Forschungsfragen zu entwickeln, Daten zu sammeln und zu analysieren, was zu neuen Erkenntnissen führt. Hierbei arbeiten Museen nicht mehr nur als Orte, die Wissen bewahren und vermitteln, sondern werden zu aktiven Zentren, die Wissen gemeinsam mit der Öffentlichkeit schaffen.
Erstellt am 13. März 2024
Mehr zum Thema Citizen Science im Museum findest du in unserem Spotlight.
Citizen Science und die Sustainable Development Goals SDG
Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen bieten einen globalen Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung. Citizen Science – die Einbindung der Öffentlichkeit in die wissenschaftliche Forschung – spielt eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieser Ziele. Hier beleuchten wir, wie Citizen Science zur Realisierung der SDGs beitragen kann und welche Potenziale und Herausforderungen damit verbunden sind. Gerne nehmen wir Beiträge und Hinweise entgegen, welche die Entwicklungen im Zusammenhang von Citizen Science und den Nachhaltigkeitszielen in der Schweiz ergänzen und diesen Spotlight vertiefen.
War Ihr Grossvater Komponist? War ihre Nachbarin Pianistin?
Workshop zum Verfassen von Artikeln für das Musiklexikon der Schweiz (MLS) - Kurzbericht vom 28.11.2023
|
Irène Minder-Jeanneret, Präsidentin des Kuratoriums Musiklexikon der Schweiz |
 |
Am 25. November 2023 organisierte die Steuerungsgruppe des MLS in Bern einen Workshop, in welchem die interessierte Bevölkerung eingeladen wurde, das Schreiben von Artikel über ihr bekannte MusikerInnen zu lernen. Der Workshop schloss an die internationale Tagung vom 23. und 24. November 2023 «Das MLS als e-Lexikon» an der Universität Bern an und wurde namentlich von der Stiftung Science et Cité unterstützt. Der partizipative Ansatz ist ein wesentlicher Bestandteil des MLS.
Für den Workshop geworben wurde über Medienmeldungen zu Handen des Schweizerischen Musikrats, der Schweizer Musikzeitung, der Tagespresse in allen Landesteilen, über Inserate in Zeitschriften von nationalen Musikverbänden, über die sozialen Medien und über die Kanäle von Sciences et Cité sowie über in Bibliotheken und Konservatorien aufgelegte Flyer (de, fr, it).
Von den 18 angemeldeten Personen haben sich drei kurzfristig wegen Krankheit abgemeldet. Fünf weitere Personen sind an einem Workshop interessiert, waren aber am 25. November nicht verfügbar. Die Anwesenden und die Interessierten vertreten die ganze Deutschschweiz und die Romandie.
Zum Ablauf des Workshops, welcher von drei Mitgliedern der Steuerungsgruppe des MLS zweisprachig (de, fr) geleitet wurde (Dr. Caiti Hauck, Dr. Marco Jorio, Dr. Irène Minder-Jeanneret): Nach der Begrüssung und der Vorstellungsrunde samt Frage nach der Motivation wurden Geschichte und heutiger Stand des MLS gezeigt, bevor das Raster erläutert wurde, in welchem die erfragten lexikografischen Informationen eingefüllt werden. Der Nachmittag – nach einem gemeinsamen Mittagessen – war der praktischen Arbeit gewidmet. Auf eine Einführung in die bibliografischen Recherchemöglichkeiten folgte das Üben mit dem Raster. Dabei wurden sie von den drei Mitgliedern des MLS unterstützt.
Evaluationen bildeten den Abschluss des Workshops. Die Teilnehmenden meldeten einerseits die Schwierigkeiten, auf welche sie gestossen waren und welche nun MLS-seitig zu Anpassungen des Rasters führten. Andererseits wurden die Teilnehmenden nach Rückmeldungen zum Workshop gebeten: Brachte er die erhofften Erläuterungen? Wurden sie ermutigt? Waren die Präsentationen aufschlussreich? Diese Fragen wurden alle positiv beantwortet; es bestand die Möglichkeit, zusätzliche Bemerkungen/Kritiken schriftlich zu melden. Bis dato sind keine eingetreten.
Fazit seitens des MLS: Der rege Zulauf zum Workshop sowie die diverse Herkunft der Teilnehmenden erfüllten unsere Erwartungen. Es fand ein konstruktiver Austausch von Wissen und Methoden statt, welche sowohl die Teilnehmenden als auch das MLS weiterbringen. Zusätzliche Workshops sind in allen Gegenden des Landes geplant. Die Teilnehmenden werden weiterhin von uns unterstützt.
Erstellt am 19. Dezember 2023
Zum ProjektMusiklexikon der Schweiz Musik in Geschichte und Gegenwart: Das Schweizer Musiklexikon für das 21. Jahrhundert
|
 |
Citizen Science Spotlight
Hier präsentieren wir einen Überblick über verschiedene Initiativen und Arbeiten im Rahmen von Citizen Science an unterschiedlichen Orten und Institutionen.
Citizen Science im Museum
Citizen Science eröffnet Museen innovative Räume des gemeinsamen Forschens und Lernens. Dies stärkt nicht nur die Verbindung zwischen Museen und Gesellschaft, sondern fördert auch die Attraktivität der Sammlungen. Museen, die sich auf diese Weise weiterentwickeln, sehen sich nicht nur mit Herausforderungen konfrontiert, sondern es eröffnen sich auch zahlreiche Chancen. Die Einbindung von Freiwilligen und die Entwicklung neuer Vermittlungs-und Forschungsformen sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Möglichkeiten, die sich Museen durch Citizen Science erschliessen können.
- Museen haben eine lange Tradition als Bindeglieder zwischen Forschung und Zivilgesellschaft
- Museen bieten langfristige physische und konzeptionelle Räume für Citizen Science mit grosser Nähe zu Bürger:innen
- Als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft schaffen sie innovative Räume und Möglichkeiten des gemeinsamen Experimentierens und Lernens
- 2022 stand beim Jahreskongress der Schweizer Museen das Thema "Teilhaben und mitwirken – Museen im Wandel" auf der Agenda des Verbands der Museen Schweiz (VMS), wobei die Betonung auf der steigenden Bedeutung von Partizipation lag und der Forderung nach einem neuen Selbstverständnis für Museen, die nicht mehr nur "für" ihr Publikum, sondern "mit" ihrem Publikum arbeiten sollen.
In der Praxis werden bereits seit vielen Jahren Citizen Science-Projekte an Museen realisiert, einige davon sind auch auf den nationalen Citizen Science-Plattformen gelistet - lass dich inspirieren oder liste dein eigenes Projekt bei uns. Die Vielzahl wissenschaftlicher Publikationen zu Citizen Science an und in Museen bietet weiterführende Einblicke und vertiefende Informationen (Beispiele und Links weiter unten).
Citizen Science im Museum – Partizipativ forschen (VMS, 2023)
Der Verband der Museen der Schweiz (VMS) hat die Impulse aus der Jahrestagung 2022 auch 2023 wieder aufgenommen und weiterentwickelt: Ende 2023 veröffentlicht der Verband eine Broschüre zum Thema Citizen Science im Rahmen seiner Publikationsreihe "Normen und Standards". Diese Broschüre bietet einen umfassenden Einblick in die Eigenarten, den Ablauf und die wichtigsten Akteursgruppen von Citizen Science. Die Publikation liefert nicht nur theoretische Grundlagen, sondern stellt auch praktische Instrumente zur Umsetzung von Citizen Science-Projekten bereit. Mögliche Stolpersteine werden ebenso beleuchtet wie inspirierende Beispiele aus Museen, um andere Einrichtungen zur Umsetzung eigener partizipativer Forschungsprojekte zu ermutigen.
Routenplaner Citizen Science im Museum
Eine hilfreiche Orientierungshilfe ist der massgeschneiderte Routenplaner für Citizen Science im Museum. Er wurde in Zusammenarbeit mit der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte (SKKG) und catta entwickelt. Dieser Routenplaner ermöglicht Museen, ein Citizen Science Projekt durchzudenken und den Grad der Partizipation besser zu verstehen und eventuell anzupassen.
Kursangebot Citizen Science Zürich/catta
Im online-Workshop «Museen und Bevölkerung forschen gemeinsam» lernen Teilnehmer:innen die Eigenart und den Ablauf eines Citizen Science-Projektes kennen, erarbeiten gemeinsam mit der Kursleitung die Landschaft der wichtigsten Akteur:innen der partizipativen Forschung in der Schweiz und können nach dem Kurs selbstständig ein eigenes Citizen Science-Projekt planen. Der Workshop wird regelmässig bei Citizen Science Zürich ausgeschrieben oder kann individuell bei catta gebucht werden.
Beispiele
Auf der nationalen Projektplattform Schweiz forscht finden sich Beispiele von Citizen Science-Projekten an Museen. public-arts.ch behandelt die Geschichte Schweizerischen Plastikausstellung/Exposition suisse de sculpture in Biel/Bienne. Geschichten, die noch fehlen vom Regionalmuseum der Luzerner Rigi-Gemeinden ist eine ethnografische Studie zum partizipativen Forschen in einer Region. Best-Practice Beispiele und Inspiration lassen sich auch auf den Plattformen von unseren Partnerorganisationen Bürger schaffen Wissen und Österreich forscht finden.
Handlungsempfehlungen Weissbuch Deutschland
Die Empfehlungen aus dem Weissbuch Deutschland (Citizen-Science-Strategie 2030 für Deutschland) bieten konkrete Leitlinien für die kollaborative Zusammenarbeit zwischen Museen und Bürger:innen. Der Bericht wurde als Arbeitsdokument veröffentlicht, um verschiedene Institutionen, darunter auch Museen, bei ihren eigenen strategischen und ganz konkreten Arbeit für Citizen Science zu unterstützen. Das Weissbuch Kapitel zu den Museen, welches unter Mitwirkung verschiedener Museen entstanden ist, ist eine umfassende Ressource für Museen, die eigene Citizen Science-Projekte konzipieren und durchführen wollen oder sich aus strategischen Gründen überlegen, sich mit dieser Forschungsmethode auseinander zu setzen. Die im Kapitel enthaltenen Empfehlungen basieren auf praktischen Erfahrungen und sollen eine Grundlage für erfolgreiche Umsetzungen bilden
Schweizer Citizen Science-Prinzipien
Die zehn Schweizer Citizen Science-Prinzipien sind eine weitere Grundlage, die bei der Konzeption oder Bewertung von Citizen Science-Projekten hinzugezogen werden können. Sie wurden 2022 nach einem partizipativen nationalen Prozess erarbeitet und publiziert und enthalten zehn Themen, die Citizen Science-Projekte charakterisieren.
Dieses Spotlight ist entstanden in Zusammenarbeit mit Anne-Laure Jean (VMS) und Pia Viviani (catta).
Citizen Science für gesellschaftlichen Mehrwert: Einblick in die Förderpraxis der Hans Sauer Stiftung
Die Hans Sauer Stiftung fördert Wissenschaft und Forschung mit einem Fokus auf technische und soziale Innovationen für gesellschaftliche Mehrwerte. Dabei setzt sie auf innovative Forschungsmethoden und -praktiken.
Das aktuelle Förderprogramm der Stiftung unterstützt Vorhaben, die wissenschaftsbasiert gesellschaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit untersuchen und dabei einen kollaborativen und ko-kreativen Citizen-Science-Ansatz verfolgen.
Wir sassen mit Veneta Gantcheva-Jenn, Leiterin des Förderprogramms, und Nadja Hempel, Mitglied des Förderausschusses, zusammen, um mehr über den Fokus auf Citizen Science bei der Hans Sauer Stiftung zu erfahren.
| Veneta Gantcheva-Jenn ist Diplom-Psychologin, arbeitet seit 2016 bei der Hans Sauer Stiftung und leitet den Förderbereich. Am Forschungsmodus Citizen Science begeistert sie insbesondere die Möglichkeit, aktuelle Fragestellungen aus der Gesellschaft in die Wissenschaft zu tragen sowie Menschen den Zugang zu Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen, die wenig Berührungspunkte dazu haben. |
 |
 |
Nadja Hempel ist Sozial- und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin (M. Sc.), seit 2018 bei der Hans Sauer Stiftung tätig und Mitglied des Förderausschusses. Ihr besonderes Interesse gilt Citizen-Science-Projekten, die mit ihrer Forschung gesellschaftliche Probleme aufgreifen und konkrete Lösungsansätze anstossen. |
1. Was versteht die Hans Sauer Stiftung unter «gesellschaftlichem Wissen»?
Unter "gesellschaftlichem Wissen" verstehen wir implizites Alltags- oder situatives Wissen von unseren Mitmenschen, das eine grundlegende Bedingung für wissenschaftliche Vorhaben darstellt. Dieses Wissen hilft oft bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme. Ein Beispiel ist ein gefördertes Projekt in Hamburg, bei dem das Wissen der BewohnerInnen eines bestimmten Viertels unerlässlich war, um die Gesundheitssituation zu verstehen und Massnahmen zur Verbesserung zu entwickeln. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft und die Berücksichtigung ihres Wissens führten zu passenden Lösungen.
2. Welche Rolle spielt dabei Citizen Science?
Citizen Science ermöglicht es, situatives Alltagswissen in den Forschungskontext einzubeziehen. Dadurch können Erkenntnisse gewonnen werden, die ohne dieses Wissen nicht möglich wären. Das Beispiel aus Hamburg zeigt, wie sich durch diesen Ansatz ein lokaler Mehrwert generieren lässt und Lösungen für lokale Probleme identifiziert werden. Die Einbindung des Alltagswissens ermöglicht eine effektivere Forschung und trägt zur Lösung lokaler Herausforderungen bei.
3. Das aktuelle Förderprogramm der Hans Sauer Stiftung unterstützt Citizen Science Projekte, die einen kollaborativen und ko-kreativen Citizen-Science-Ansatz verfolgen. Wie kam es dazu, dass Citizen Science als Schwerpunkt für die aktuelle Förderperiode gewählt wurde?
Die Stiftung verfolgt das Ziel, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und Transformationsprozesse zu initiieren und zu begleiten. Ihre Prinzipien sind Partizipation, Transdisziplinarität, Gestaltung und Innovation. Da Citizen Science diese Prinzipien unterstützt und die Verbindung zum Stiftungszweck besteht, wurde es als Schwerpunkt gewählt. Die Stiftung fördert Projekte mit einem kollaborativen Charakter, bei denen Beteiligte frühzeitig und intensiv in den Forschungsprozess einbezogen werden.
4. Welche neuen Perspektiven haben sich euch durch die Förderung von Citizen-Science-Projekten eröffnet?
Das Fördern von Nischenprojekten hat gezeigt, dass mutige Ideen positive Ergebnisse bringen können. Durch die Teilnahme an Konferenzen und Austausch mit Projekten konnte die Stiftung besser verstehen, was diese im Projektalltag benötigen. Diese Perspektiven werden für zukünftige Förderprogramme berücksichtigt. Die Stiftung hat auch für sich selbst viel Erkenntnisgewinn erlangt und wir können uns gut vorstellen, in Zukunft ein eigenes Citizen Science Projekt zu realisieren.
5. Wie viele Anträge habt ihr bisher erhalten und wer kann alles einen Antrag stellen?
Die Stiftung hatte das Ziel, ein faires Verhältnis zwischen Anträgen und Förderpaketen zu erreichen, das ist mit einer Quote von 4,5:1 gelungen.
Die Förderung richtet sich an gemeinnützige Organisationen und Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Sitz in Deutschland, einschliesslich Hochschulen und Universitäten, die Projekte im Bereich Wissenschaft und Forschung planen. Dabei möchte die Stiftung auch gezielt kleinen Organisationen und Projekten eine faire Chance bieten. Wir führen vor der Antragstellung Beratungsgespräche, um bei der Entwicklung der Ideen zu helfen und den Aufwand für die Antragstellenden zu minimieren.
6. Welche Kriterien habt ihr für die Auswahl der geförderten Projekte definiert?
Wir haben insgesamt 17 Kriterien definiert und auf der Website des Förderprogramms transparent gemacht. Wichtige Kriterien sind ein durchdachtes Beteiligungskonzept, das eine hohe Partizipation ermöglicht. Die Stiftung legt auch Wert auf Kooperation und Zugänglichkeit des Forschungsvorhabens, zum Beispiel durch die Übernahme von Fahrtkosten oder die Bereitstellung von Kinderbetreuung für Citizen Scientists. Eine transparente Kommunikation von Seiten der Berufsforschenden, etwa bei der Definition von Erwartungen und Arbeitsumfang, ist uns auch sehr wichtig. Die Stiftung erwartet nicht, dass ein Projekt alle 17 Kriterien erfüllt, sondern betrachtet sie als Orientierungsrahmen. Ein viel diskutiertes Kriterium ist die Innovativität, bei der es darum geht, dass Projekte nicht zwingend etwas völlig Neues erfinden müssen, auch können sie Altbewährtes in einem neuen Kontext ausprobieren.
7. Was bedeutet transformatives Potenzial?
Das transformative Potenzial bezieht sich darauf, wie ein Projekt fundierte Erkenntnisse und gemeinschaftlich getragene Lösungsansätze für gesellschaftliche Herausforderungen generieren kann, wie etwa beim zuvor genannten Beispiel aus der Stadt Hamburg. Dabei spielt Citizen Science eine wichtige Rolle. Solche Transformationsprozesse können die Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger beeinflussen und zur Unterstützung sozialpolitischer Prozesse dienen, indem konkrete Massnahmen für die Politik formuliert werden.
8. Welche Mechanismen können Förderorganisationen schaffen, um das transformative Potenzial von Citizen Science effektiver auszuschöpfen?
Förderorganisationen können spezifische Projektphasen unterstützen, wie zum Beispiel die Evaluationsphase. Die Hans Sauer Stiftung fördert besonders gern Projekte, bei denen die BürgerInnen aktiv am Forschungsprozess beteiligt sind, auch bei der Interpretation und Nutzung der Ergebnisse und nicht als blosse Datenlieferanten dabei sind.
9. Als Teil des Förderantrags verlangt ihr von den Initiatorinnen unter anderem ein Partizipationskonzept. Was ist damit genau gemeint und weshalb ist es für Citizen Science relevant?
Ein ausgearbeitetes Partizipationskonzept verlangen wir nicht. Ein gutes Citizen Science Projekt sollte ein Plan haben, wie alle Akteure und insbesondere die Citizen Scientists am Forschungsprozess beteiligt werden. Die genaue Ausgestaltung kann je nach Projekt variieren und sollte die Präferenzen und Bedürfnisse der BürgerInnen berücksichtigen. Eine transparente und partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist dabei von grosser Bedeutung. Ein mögliches Instrument zur Umsetzung von Partizipation ist die Definition von Partizipationsstufen in einem Projektzeitplan. Für jede Projektphase wird skizziert, auf welcher Ebene die Partizipation stattfinden soll. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wertschätzung und Anerkennung aller Beteiligten zum Beispiel durch Aufwandsentschädigungen, Beteiligung an Veröffentlichungen und durch gemeinsame Veranstaltungen.
10. Ihr sprecht von transparenter Kommunikation? Welche Rolle spielt diese bei der Bewertung von Citizen-Science-Projekten?
Transparente Kommunikation spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Citizen-Science-Projekten. Die interne Kommunikation zwischen allen Kooperationspartnern ist wichtig, um den Projekterfolg zu gewährleisten. Die BürgerInnen sollten über den Verlauf des Projekts informiert werden und Rückmeldungen über die Nutzung der Daten und die erzielten Ergebnisse erhalten.
Allerdings legt die Stiftung weniger Wert darauf, dass ein Projekt eine perfekte Öffentlichkeitsarbeit nachweisen kann oder dass am Ende eine wissenschaftliche Publikation steht.
11. Wie wird in den Projekten die wissenschaftliche Qualität der erhobenen Daten und Ergebnisse sichergestellt und welche Evaluations- und Reflexionsmassnahmen werden durchgeführt?
Die Stiftung befürwortet Evaluations- und Reflexionsphasen als Teil des Projekts, die im Antrag ersichtlich werden. Kooperationen mit Universitäten oder eine Projektbegleitung durch Wissenschafter*innen werden zudem positiv bewertet, das Fehlen solcher ist jedoch kein Ausschlusskriterium. Ein Beispielprojekt, das gefördert wird, befasst sich mit der Zukunft des Wohnens und wurde von einer zivilgesellschaftlichen Organisation eingereicht. Sie haben sich die Universität in Lüneburg als Kooperationspartner geholt, die über Expertise in quantitativen Nachhaltigkeitsmethoden verfügt. Die Citizen Scientists erhalten während des Projekts regelmässige Sprechstunden an der Universität, in denen sie Probleme bei der Datenerhebung besprechen und sich von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen beraten lassen können. Dies wird als positives Zeichen dafür gewertet, dass das Projekt eine hohe Qualität erreicht. Es geht uns allerdings nicht in erster Linie um Exzellenzansprüche an das wissenschaftliche Arbeiten, sondern vielmehr um Erkenntnisgewinn für gesellschaftliche Fragestellungen der Nachhaltigkeit und um gemeinsame Lernprozesse und Wissensproduktion.
12. Welche Impulse spürt ihr aus der Schweiz?
Wir sind begeistert von der Citizen Science-Community und den Vernetzungen zwischen der Schweiz, Österreich und Deutschland. Die Zusammenarbeit auf Konferenzen und der Austausch von Veröffentlichungen haben uns inspiriert. Insbesondere die zehn Citizen Science-Prinzipien aus der Schweiz haben uns als Inspirationsquelle für unsere Kriterien gedient.
Erstellt am 12. Dezember 2023
Digitale Tools für (geistes-) wissenschaftliche Projekte
Am diesjährigen DARIAH-CH* Study Day durfte Tizian Zumthurm, Projektleiter im Programm Citizen Science, Teil des eröffnenden Roundtables zum Thema Citizen Science und Crowdsourcing in den Geisteswissenschaften sein. Zusammen mit Yvonne Schweizer von publics-arts.ch (Crowdsourcing zur Schweizerischen Plastikausstellung Biel) und Vera Chiquet von PIA (Participatory Knowledge Practices in Analogue and Digital Image Archives) sprach er über Möglichkeiten und Herausforderungen von Citizen Science und Crowdsourcing in den Geisteswissenschaften. Eine wichtige Feststellung war, dass sich digitale Archive oder Datenbanken von analogen vor allem dadurch unterscheiden, dass sie weniger als langfristige Lagerung dienen, sondern vielmehr als Plattform zur öffentlichen Wissensgenerierung und Kommunikation. Deshalb ist bei Projekten mit digitalen Datenbanken ein Citizen Science Ansatz besonders vielversprechend. Wir sprachen über die Motivierung und Aktivierung von Freiwilligen, über digitale Methoden und analoge Apéros. Beide Projekte nutzen digitale Werkzeuge nicht nur zur Archivierung und Erschliessung ihres Materials, sondern auch zu dessen Nutzbarmachung und Analyse. Citizen Scientists gewinnt und trainiert man aber immer noch besser im analogen als im digitalen Raum, so die Erfahrungen aus den Projekten. Starke lokale Partner:innen sind hierbei sehr hilfreich. Wichtig ist auch eine eigene physische Präsenz im öffentlichen Raum sowie, natürlich, ein regelmässiger und wertschätzender Austausch auf Augenhöhe mit den Citizen Scientists.
|
Tizian Zumthurm ist Projektleiter im Bereich Citizen Science bei Science et Cité und ist Mitglied der Arbeitsgruppe Open Science der Akademien der Wissenschaften Schweiz. |
 |
Der restliche Study Day hatte zum Ziel, Forschende aus den Digital Humanities mit Anbietenden von digitalen Forschungsinfrastrukturen zu vernetzen und präsentierte Beispiele aus der Praxis. Digitale Forschungsinfrastrukturen sind für Citizen Science Projekte nicht nur deshalb relevant, weil immer mehr Förderinstitutionen im Zuge von Open Science den offenen Zugang zu Forschungsdaten zur Bedingung machen, sondern weil ein solcher Zugriff für partizipative Ansätze oftmals unabdinglich ist. Ganz abgesehen davon teilen Citizen Science und Open Science zentrale Werte wie Transparenz, Offenheit und Mitbenutzung.
“Digitale Forschungsinfrastrukturen sind für partizipative Ansätze oftmals unabdingbar.”
Der SSH Open Market Place* ist ein europäisches Portal, welches digitale Ressourcen für die Geistes- und Sozialwissenschaften sammelt und kuratiert und deshalb besonders zu Beginn eines Forschungsprojekts eine wertvolle Plattform ist. Speziell zu erwähnen sind die zahlreichen how-to Workflows, welche Vorgehensweisen, Hilfestellungen und Tool-Vorschläge für spezifische und allgemeine Frage- und Problemstellungen bieten.
Weiter stellten sich am Study Day einige digitale Forschungsinfrastrukturen aus der Schweiz vor. Alle Repräsentant:innen unterstrichen, dass es den Prozess vereinfacht, wenn man sie möglichst früh kontaktiert. Dies macht bereits vor der Antragseingabe Sinn, damit man zusammen einen soliden Data Management Plan erarbeiten kann. Dieser ermöglicht, die künftige Arbeit besser zu strukturieren und zum Beispiel einzuschätzen, welche Metadaten besonders erhebenswert sind und welcher Aufwand damit verbunden ist.
Nachfolgend listen wir einige der präsentierten Repositorien auf:
DaSCH (Swiss National Data and Service Center for the Humanities) ist mittlerweile SNF finanziert und versteht sich als Langzeitrepositorium für qualitative Daten, selbstverständlich unter Einhaltung der FAIR Prinzipien. Gleichzeitig ist es dank direktem Zugriff auf die Objekte aber auch als Arbeitsinstrument während der Laufzeit des Projekts gedacht. Das Repositorium erlaubt direkten Zugriff und Suchbarkeit für Menschen und Maschinen. Durch Persistent Identifiers auf Objektebene ermöglicht das Repositorium eine präzise Referenzierung und Versionierung; laufende Änderungen sind also möglich und nachvollziehbar.
SWISSUbase spezialisiert auf Sozial- und Sprachwissenschaften und wird ab 2024 auch für Geisteswissenschaften geöffnet. Es handelt sich um eine mehrsprachige FAIR Plattform zum Teilen und Archivieren von Forschungsdaten mit reichhaltigen disziplin-spezifischen Metadaten. SWISSUbase wird betrieben von FORS (Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften) sowie den Universitäten Lausanne, Neuchâtel und Zürich und bietet auch Konsultationen und zum Kuratieren und Publizieren von Daten.
LirI ist die Linguistic Research Infrastructure der Universität Zürich und interessant für alle sprachbasierte Forschung. Sie bieten Unterstützung bei der Sammlung, Analyse und Archivierung von Daten. Sie bieten zudem Räumlichkeiten und Equipment zur Sprachforschung und via Swissdox Zugriff auf unzählige Medienartikel.
Der CollectionBuilder (entwickelt an der University of Idaho, vorgestellt von Stadt.Geschichte.Basel) ist eine schlanke und kostenlose open-source Option zur Erstellung und zum Hosten von digitalen Sammlungen, Ausstellungen und Geschichten. Diese Lösung erfordert nur wenig eigene Infrastruktur und technisches Know-How.
Geovistory ist eine Linked Open Data Infrastruktur für Geistes- und Sozialwissenschaften. Sie wird gemeinsam von KleioLab, LARHRA, der Universität Bern und anderen Akteuren entwickelt und durch das LOD4HSS-Projekt, von swissuniversities mitfinanziert, strukturiert. Die Plattform ist nicht nur ein FAIR Repositorium für einzelne Projekte, sondern hat zum Ziel, die Daten und Objekte aus den verschiedenen Projekten zu verknüpfen und so nutzbarer zu machen.
nodegoat ist eine web-basierte virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften (entwickelt vom LAB1100, vorgestellt von den Digital Humanities der Universität Bern). Sie bietet diverse Möglichkeiten für Datenmanagement und -modellierung und ermöglicht verschiedene Visualisierungen (geographische Karten, Netzwerkgraphen, Diagramme ,etc.) und interaktive Datenpublikation.
Diese digitalen Forschungsinfrastrukturen für die Geisteswissenschaften, welche häufig auch für andere Disziplinen geeignet sind, bieten also vielfältige Möglichkeiten. Die offene Archivierung der Daten und der freie Zugriff darauf sind dabei oft nur die Grundlage. Viele Tools bieten auch einfache Bearbeitung, Visualisierung, Analyse und Präsentation der Daten und Ergebnisse. All das ist natürlich auch für die meisten Citizen Science Projekte spannend und relevant.
Vielen Dank an die Digital Humanities Community für die anregenden Diskussionen und die spannenden Einblicke in Projekte, Daten und Infrastrukturen! Die Folien aller Vorträge sind hier abrufbar.
Erstellt am 27. November 2023
* DARIAH steht für Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities. DARIAH ist ein ERIC, was wiederum für European Research Infrastructure Consortium steht. Hierbei handelt es sich um eine besondere Rechtsform, welche die Gründung und den Betrieb von neuen oder bestehenden Forschungsinfrastrukturen mit europäischem Interesse erleichtert. Die Schweiz ist Mitglied einiger ERICs und hat Beobachterstatus bei anderen. Das SBFI führt eine Liste. Wie viele ERICs ist DARIAH in nationalen Konsortien oder Nodes organisiert. DARIAH-CH wurde im November 2021 von acht universitären Hochschulen und der SAGW gegründet wird heute von DaSCH koordiniert.
* Der Market Place ist Teil des Social Sciences and Humanities Open Cloud Projekts (SSHOC), welches wiederum Teil der European Open Science Cloud EOSC der Europäischen Kommission ist. EOSC bietet Forschenden – explizit auch Citizen Scientists – eine virtuelle Umgebung mit offenen Diensten für die Speicherung, Verwaltung, Analyse und Wiederverwendung von Forschungsdaten über Grenzen und wissenschaftliche Disziplinen hinweg.
CitSciHelvetia'25 - Citizen Science in Action
Citizen Science Helvetia 2025 (CitSciHelvetia'25), die Schweizer Konferenz über Citizen Science und partizipative Forschung, wird am 5. und 6. Juni 2025 an der Universität Lausanne (UNIL) stattfinden und sich mit dem Thema “Citizen Science in Action. Zusammenarbeit zwischen der Zivilgesellschaft und der akademischen Welt” beschäftigen.
CitSciHelvetia'21 - Citizen Science in der Schweiz vernetzen
Die erste Schweizer Citizen Science Konfernez CitSciHelvetia'21 fand online statt und diente dazu, die Akteur:innen der Citizen Science in der Schweiz zusammenzubringen und ihre verschiedenen Ansätze und Projekte zu vernetzen