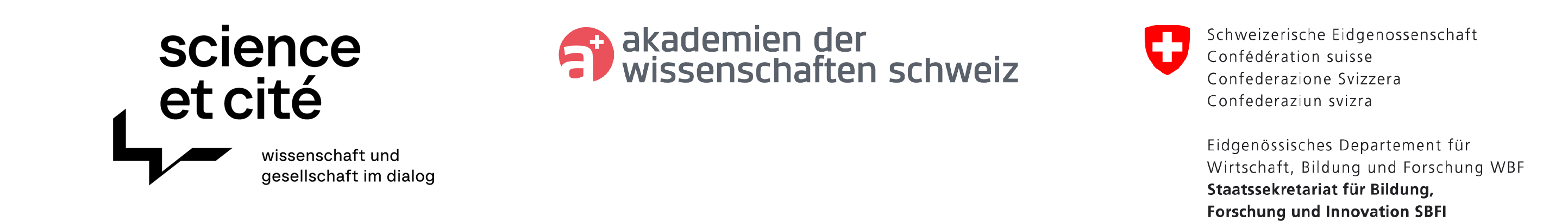«Museum Sangallense» –Eine Sammlung, die Geschichte schreibt
Entziffern Sie mit uns historische Handschriften und schreiben Sie Bibliotheksgeschichte!
Student:innen und Senior:innen forschen gemeinsam zur Geschichte der Fremdplatzierung
In der Schweiz wurden allein im 20. Jahrhundert mehrere Hunderttausend Kinder und Jugendliche fremdplatziert, d.h., sie durften nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, sondern sind in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht worden. In dem Citizen-Science-Projekt «Was war bekannt?» haben Wissenschaftler:innen und Bürger:innen durch Zeitungsanalysen gemeinsam herausgefunden, was die Öffentlichkeit über die Lebensverhältnisse der fremdplatzierten Minderjährigen wissen konnte. Die zentralen Ergebnisse der Studie sind auf der Projektwebsite und in einem Magazin zusammengefasst.
|
Dr. Michèle Hofmann ist Leiterin der Forschungsstelle Historische und vergleichende Kindheits- und Jugendforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. Sie hat das Citizen-Science-Projekt «Was war bekannt?» gemeinsam mit Prof. Dr. Franziska Oehmer-Pedrazzi (Fachhochschule Graubünden) und Dr. Philipp Hubmann geleitet. |
|
Das Projekt
Am Anfang des Projekts stand die Idee, interessierten Bürger:innen verschiedener Altersstufen Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten und das Thema Fremdplatzierung zu geben und sie darüber in Austausch zu bringen. Das Ziel war es, gemeinsam eine Antwort auf die Frage zu finden, wie Fremdplatzierung im Mediendiskurs der Schweiz im 20. Jahrhundert verhandelt wurde. Die unterschiedlichen (Lebens-)Erfahrungen der Co-Forschenden sollten als wichtiger Bezugsrahmen bei der Diskussion und Analyse von Quellenfunden dienen.
Bürgerforscher:innen finden
Die Projektleitenden versuchten auf verschiedenen Wegen, Bürgerforscher:innen zu finden, die an dem Projekt mitarbeiten wollten. Dafür richteten sie einen Instagram-Kanal ein, produzierten ein Trailer-Video, versandten einen Aufruf per E-Mail und verteilten Flyer. Wichtig war, dass die Geschäftsstelle der Senior:innen-Universität Zürich den Aufruf zur Mitarbeit an ihre Mitglieder weiterleitete (der Versand musste vorgängig beantragt und bewilligt werden). Durch diesen Aufruf konnten mehrere sehr engagierte Bürgerforscher:innen für das Projekt gewonnen werden. Diese haben für die Website und das Magazin Beiträge zur Geschichte der Fremdplatzierung verfasst, auf Instagram über das Projekt gepostet und ausserdem ihre Erfahrungen mit Citizen Science geteilt: in einem schriftlichen Bericht auf der Projektwebsite und in einem Porträt für das Schweizer Forschungsmagazin «Horizonte».
Nebst den Senior:innen bildeten Student:innen eine zweite grössere Gruppe von Projektmitarbeiter:innen. Bachelor- und Masterstudierende des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich besuchten im Rahmen des Projekts ein oder sogar zwei Forschungspraktika. Die Student:innen leisteten dabei nicht nur die durch die Praktika vorgegebenen Arbeitsstunden, sondern sie investierten viel mehr Zeit in das Forschungsprojekt, nahmen an den regelmässig stattfindenden Treffen teil und brachten ihre Ideen ein. Sie wurden so zu einem festen Bestandteil des Projektteams und damit zu eigentlichen Bürgerforscher:innen. Teil des Projektteams war auch eine im Masterstudiengang Bildungswissenschaften an der Universität Basel eingeschriebene Studentin. Alle studentischen Bürgerforscher:innen haben einen oder sogar mehrere Beiträge für die Projektwebsite und das Magazin geschrieben. Eine Studentin berichtete ausserdem in einem Video-Interview von ihren Erfahrungen mit Citizen Science.
Gemeinsame Zeitungsrecherche
Die Bürgerforscher:innen haben nach einer Einführung zum methodischen Vorgehen zwei überregionale und auflagenstarke Schweizer Tageszeitungen recherchiert: die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und die Berner Zeitung Der Bund. Gesucht wurden Zeitungsartikel, die einen Bezug zur Thematik der Fremdplatzierung aufweisen. Die grosse Menge an gedrucktem Papier verunmöglichte es, alle Ausgaben der beiden Zeitungen für das gesamte 20. Jahrhundert durchzusehen. Das Projekt konzentrierte sich deshalb auf einzelne Untersuchungszeiträume, die aufgrund von bestimmten Ereignissen, die für die Geschichte der Fremdplatzierung bedeutsam sind, als besonders vielversprechend schienen. Die NZZ wurden in der Zentralbibliothek Zürich im Original (Printausgaben) durchgeblättert und Der Bund auf der Online-Plattform E-Newspaper Archives durchgesehen. Beim Durchblättern der einzelnen Zeitungsausgaben war es das Ziel, in die Medienberichterstattung des 20. Jahrhunderts einzutauchen. Die Teilnehmer:innen sollten so einen konkreten Eindruck von dem historischen Kontext, in dem die Berichterstattung über Fremdplatzierung eingebettet war, erhalten. Die recherchierten Zeitungsartikel wurden in einer gemeinsamen Datenablage abgespeichert. Im Anschluss an die Recherche haben die Bürgerforscher:innen ausgewählte Zeitungsartikel analysiert und basierend auf ihrer Analyse Texte für die Website und das Magazin verfasst.
Generationenübergreifende Zusammenarbeit
Das Projektteam, bestehend aus den Citizen Scientists, den Projektleiter:innen und einer Supervisorin, hat sich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren regelmässig getroffen, um den Zwischenstand der Recherche zu diskutieren und die weiteren Schritte zu planen. Die Treffen und das Projekt insgesamt zeichneten sich durch eine sehr gelungene Zusammenarbeit von jungen und älteren Citizen Scientists aus. Die Projektleitenden hatten sich vom Einbezug von Bürger:innen verschiedener Altersstufen versprochen, dass deren unterschiedliche (Lebens-)Erfahrungen die Diskussion und Analyse von Quellenfunden bereichern würden. Und das war auch tatsächlich der Fall. Während den Älteren bestimmte Fremdplatzierungsmassnahmen wie etwa die «Verdingung» von Kindern und Jugendlichen auf Bauernhöfen, die bis in die frühen 1980er-Jahren Bestand hatte, oder auch die Debatten rund um die Auflösung des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» in den 1970er-Jahren bestens bekannt waren, waren die Jüngeren damit weniger oder gar nicht vertraut. Die studentischen Bürgerforscher:innen konnten dafür ihr Wissen aus dem Studium in die Diskussionen einfliessen lassen. Der generationenübergreifende Austausch beschränkte sich nicht auf die Projekttreffen, einzelne Student:innen und Senior:innen bildeten auch Tandems und arbeiteten in dieser Konstellation themenspezifisch zusammen. Die generationenübergreifende Zusammenarbeit wurde nicht nur von den Beteiligten sehr geschätzt, sondern sie hat auch das Projekt und die Forschungsergebnisse bereichert.
Veröffentlicht am 29. April 2025.
Gesichter der Erinnerung
«Gesichter der Erinnerung» beleuchtet ein bedeutendes Kapitel Schweizer Sozialgeschichte, das bis heute nachwirkt: fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Mehrere 100'000 Menschen sind davon betroffen. 32 von ihnen sprechen im Rahmen des Projekts über ihre Erfahrungen und geben der Geschichte ein Gesicht.
Seit einigen Jahren wird die gesellschaftspolitische und wissenschaftliche Aufarbeitung von sogenannten fürsorgerischen Zwangsmassnahmen vorangetrieben. Die Erfahrungen als Heimkind, Pflegekind, einer Adoption unter Zwang, administrative Internierungen, Sterilisationen und Kastrationen unter Zwang und unfreiwillige Medikamententests wirken nach. Gesichter der Erinnerung leistet einen Beitag zu dieser Aufarbeitung.
Worum geht es in dem Projekt?
Mit der dokumentarischen und multimedialen Onlineplattform «Gesichter der Erinnerung» wollen wir ein wichtiges und gleichzeitig für viele Menschen traumatisierendes Stück Schweizer Sozialgeschichte auf neuartige Weise zugänglich machen. Im Zentrum stehen die Erfahrungen von Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Zu Wort kommen Betroffene, Partnerinnen, Kinder und Berufspersonen.
Wer kann mitforschen und wie?
Das ursprüngliche Projekt aus dem Jahr 2022 ist bereits abgeschlossen, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, ein Heim oder eine Einrichtung zu melden. Diese werden dann online auf einer Landkarte verzeichnet.
Damals entstand die Onlineplattform «Gesichter der Erinnerung», ein gemeinsames Projekt von Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen sowie Historikerinnen und Historikern. Es bestanden unterschiedliche Formen der Mitwirkung: Konzeption des Projektes, Geldsuche, Schwerpunkte setzen, Teilen der eigenen Erfahrung, Führen von Interviews, Ausarbeitung der Webplattform und Promotion (Veranstaltungstour, Medienarbeit).
Wie wirkt das Projekt nach?
Webseite:
- Die Ergebnisse und Erinnerungen wurden 2022 auf der Webseite www.gesichter-der-erinnerung.ch aufgeschaltet
- 2024 kamen die französische und englische Übersetzung dazu
- 2025 folgt die italienische Version
Lernen und Forschen:
- Zusammen mit der PH Luzern wurden Schulunterlagen (Sek I und II) erarbeitet
- Die Rohdaten stehen der Forschung im Archiv für Zeitgeschichte (AFZ) zur Verfügung
- Der Verein hat an der Erarbeitung der Lern-App «Fürsorge und Zwang» mitgewirkt
- Installation: Fremdplatziert. Erfahrungen Schweiz | 14.01.2025 - 27.04.2025 | Landesmuseum Zürich
- Ausstellung: Vom Glück vergessen | 20.02. 2025 bis 11.01.2026 | Bernisches Historisches Museum
2023 stand das Projekt auf der Short-List für den Föderalismuspreis.
Medizin im Dorf
Gemeinsam sammeln wir Medizingeschichte(n) aus Graubünden.
Worum geht es in dem Projekt?
Zur Geschichte der institutionellen medizinischen Versorgung und zur klinischen Medizin wurde in den letzten Jahren einiges publiziert. Noch wenig wissen wir über die Veränderungen der medizinischen Versorgung in den letzten Jahrzehnten in Graubünden. Das Wissen dazu lagert in den Köpfen der einheimischen Bevölkerung. Es sind eigene Erinnerungen sowie Geschichten und Traditionen, die weitererzählt und in der Familie weitergegeben werden. Damit dieses Wissen nicht verloren geht, tragen wir die vielfältigen Erfahrungen zusammen und ordnen sie historisch ein.
Medizinische Versorgung beinhaltet die klinische Medizin wie auch die unter dem Sammelbegriff der Komplementärmedizin zusammengefassten Formen und die sogenannte Volksmedizin.
Wer kann mitforschen und wie?
In Projekt «Medizin im Dorf» setzen wir gemeinsam mit der Bevölkerung Schwerpunkte und «Geschichtsdetektivinnen» und «Geschichtsdetektive» können selbst Interviews führen und damit Inhalte aktiv mitgestalten. Die Interviews werden aufgenommen. Alle Co-Forschenden haben eine Interviewschulung erhalten und die Handhabung der Aufnahmegeräte sowie Interviewtechniken geübt.
Was passiert mit den Resultaten?
2023 sind wir im Bündner Oberland in Kooperation mit dem Museum Regiunal Surselva gestartet. Seit Anfang 2025 sind die ersten Ergebnisse auf der Webseite www.medizin-im-dorf.ch zugänglich. Neben den Interviews geben Hintergrundtexte, Bilder und Geschichten Einblick in die Geschichte der medizinischen Versorgung im Dorf. Die Webseite wächst weiter und das Projekt «Medizin im Dorf» geht auch ins Oberengadin. Wir sind zudem auf der Suche nach «Rezepten und ihren Geschichten» aus dem gesamten Kanton, die online eingereicht werden können.
 Projekttreffen Medizin im Dorf, Foto: Geschichtspunkte GmbH
Projekttreffen Medizin im Dorf, Foto: Geschichtspunkte GmbH
Prachtsatlanten 2 – Sprung ins 18. Jahrhundert
Worum geht es in dem Projekt?
Für interessierte Freiwillige stehen 2256 unterschiedlichste Landkarten sowie Pläne von Städten und Befestigungsanlagen aus drei Jahrhunderten zur geografischen Verortung bereit. Online werden auf alten und heutigen Landkarten übereinstimmende Punkte identifiziert. Die alten Karten werden darauf automatisch entzerrt und lassen sich darauf einfacher mit anderem Kartenmaterial vergleichen.
Nach dem erfolgreichen Georeferenzierungsprojekt «Prachtsatlanten» im letzten Jahr spannt das neue Mitmach-Projekt zeitlich den Bogen weiter vom 16. bis ins 18. Jahrhundert.
Wie können Bürger:innen mitforschen?
Jetzt referenzieren: https://zb.oldmapsonline.org/maps/d2440423-92aa-4e05-9707-e0bce29453c4/georeference?queue=Prachtsatlanten2
Was passiert mit den Resultaten?
Die digitalisierten Karten stehen neben den vollständigen Atlanten in der Kollektion «Prachtsatlanten» auf der Plattformen e-rara zur Verfügung.
Das Projekt ist Teil des strategischen Schwerpunkts Citizen Science der Zentralbibliothek Zürich.
Musiklexikon der Schweiz
Musik in der Schweiz in Geschichte und Gegenwart: Das Schweizer Musiklexikon für das 21. Jahrhundert
Das Musiklexikon der Schweiz (MLS) ist das spartenübergreifende und mehrsprachige Online-Fachlexikon zur Schweizerischen Musikgeschichte. Es versteht sich als multimediale Informationsplattform zum historischen und heutigen Musikleben in der Schweiz und richtet sich sowohl an Musikerinnen und Musiker, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende als auch an Interessierte aus der breiten Öffentlichkeit. Das MLS dokumentiert sowohl Persönlichkeiten der Schweizer Musikgeschichte wie auch Orte, Institutionen und Themen aus allen Sparten des Musiklebens.
Komponierte Ihr Grossvater? War Ihre Nachbarin Pianistin? Schreiben Sie darüber!
Im Workshop leiten wir an, wie man recherchiert, Material aufbereitet und Artikel für das Musiklexikon der Schweiz schreibt.
Das MLS setzt auf kulturelle Teilhabe, denn wir unterstützen Gruppen und Einzelpersonen dabei, die lokale Musikkultur mit Worten, Bildern und Klängen zu dokumentieren. In diesem Workshop leiten wir an, wie beispielsweise Information, die in Familien- oder Vereinsarchiven liegen, aufgearbeitet werden, um sie im Lexikon zugänglich zu machen. Autorinnen und Autoren werden während und nach dem Workshop von den Mitgliedern des Kuratoriums «Musiklexikon der Schweiz» betreut.
Der Workshop ist Teil des Themenzyklus «Kulturelle Teilhabe» der Veranstaltungsreihe RECTO VERSO der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) und steht allen Interessierten offen. Er ist dreisprachig (DE, FR, IT) und findet im Anschluss an die Tagung «Musik in der Schweiz in Geschichte und Gegenwart: Das Musiklexikon der Schweiz für das 21. Jahrhundert» (23.-24. November 2023) statt. Beiträge in rätoromanischer Sprache sind willkommen.
Workshop am 25. November 2023 in Bern, Institut für Musikwissenschaft, Mittelstrasse 43, 3012 Bern; 10.15 bis 16.45 Uhr
Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch
Für einen Einblick in den vorläufigen Stand des MLS empfehlen wir den Besuch der Beta-Version: https://mls.0807.dasch.swiss.
Der Workshop ist der Praxisteil der Tagung "Musik in der Schweiz in Geschichte und Gegenwart"
Datum: 23.-24. November 2023
Tagungssprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch Tagungswebsite: www.musik.unibe.ch/lexikografie
Was war bekannt? Das Thema «Fremdplatzierung» in Schweizer Tageszeitungen
In der Schweiz wurden allein im 20. Jahrhundert mehrere Hunderttausend Kinder und Jugendliche sogenannt fremdplatziert, d.h., sie durften nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, sondern sind in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht worden.
In dem Citizen-Science-Projekt «Was war bekannt?» hat ein Forscher:innenteam der Universität Zürich und der Fachhochschule Graubünden durch Zeitungsanalysen gemeinsam mit interessierten Bürger:innen herausgefunden, was die Öffentlichkeit über die Lebensverhältnisse der fremdplatzierten Minderjährigen wissen konnte. Recherchiert und analysiert wurden Artikel, die in der Neuen Zürcher Zeitung und der Berner Tageszeitung «Der Bund» in vier Untersuchungszeiträumen (1923–1928, 1937–1944, 1968–1972, 1974–1981) veröffentlicht worden sind.
Auf der Projektwebsite und in einem Magazin sind die zentralen Ergebnisse der Studie zusammenfassend dargestellt. Die Studienergebnisse sind systematisiert nach Beiträgen, die sich mit dem Thema «Fremdplatzierung» in allgemeiner oder übergreifender Weise beschäftigen, Artikel, die sich der Heimunterbringung widmen, sowie Analysen, die sich mit den fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien auseinandersetzen. Die Beiträge wurden mehrheitlich von den Citizen Scientists eigenständig verfasst. Die gesammelten Erfahrungen beim gemeinsamen Forschen sind ebenfalls auf der Projektwebsite dokumentiert.
Geschichten, die noch fehlen. Eine ethnografische Studie zum partizipativen Forschen in einer Region
Eine Region kann nie vollständig in der Öffentlichkeit dargestellt werden: Aus der Vielzahl möglicher Repräsentationen muss stets eine Auswahl getroffen werden. So kommt es, dass einige Geschichten in Publikationen, Ausstellungen und auf Websites erzählt worden sind, andere hingegen fehlen. Im Projekt interessieren wir uns dafür, welche Themen in den bisherigen Veröffentlichungen nicht berücksichtig worden und wer nicht zu Wort gekommen ist. Wir fragen Personen aus der Region, welche Geschichten aus ihrer Sicht fehlen und laden sie dazu ein, sich mit Erzählungen, Bildern und Objekten an der Darstellung der Region zu beteiligen.
Das Projekt wird mit dem Museum Vitznau-Rigi in den Luzerner Rigi-Gemeinden Greppen, Vitznau und Weggis durchgeführt. Diese Gemeinden bilden eine Exklave des Kantons Luzern und sind stark durch den Tourismus geprägt, wodurch sich stets Fragen nach Fremd- und Selbstbildern gestellt haben. Mit der Repräsentation dieser Region beschäftigt sich das Museum intensiv. Es handelt sich um eines der vielen Lokalmuseen in der Schweiz, die in Freiwilligenarbeit von Personen aus der Bevölkerung aufgebaut worden sind und die über Erfahrung in partizipativen Vorhaben verfügen.
Diese Erfahrung ermöglicht es, im Projekt auch nach den Möglichkeiten und Schwierigkeiten partizipativen Forschens in einer Region zu fragen. Dazu ist die Untersuchung nicht als externe Begleitstudie, sondern als Feldforschung angelegt. Indem wir das partizipative Forschen partizipativ erforschen, wollen wir Erkenntnisse zum Potenzial dieses Forschungsansatzes gewinnen.
Schul(zeit)reisen
Für Lehrpersonen an Gymnasien und weiterführenden Schulen bieten wir kostenfrei Arbeitsmaterialien zur Ergänzung oder Vertiefung des Unterrichts an Mittelschulen.
Worum geht es in dem Projekt konkret?
Einzelne didaktische Einheiten stellen jeweils originale Dokumente aus der Zentralbibliothek Zürich und ihren Spezialsammlungen in den Mittelpunkt. Diese werden in einen thematischen Rahmen gestellt, erläutert und für Lehrerinnen und Lehrer mit weiterführenden Literaturhinweisen ergänzt.
Wie können Sie mitforschen?
Wir starten dieses neue Angebot als Pilotprojekt mit Materialien zur Geschichte und Kulturgeschichte. Einheiten zu weiteren Fächern werden in regelmässigen Abständen dazukommen. Dabei sind wir auf Rückmeldungen von Ihnen, den Lehrerinnen und Lehrern, angewiesen! Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Kritik und Fragen. Wünschen Sie sich ein spezielles Thema? In einem nächsten Schritt laden wir Sie herzlich dazu ein, sich selbst mit unserem digitalisierten Quellenmaterial auseinanderzusetzen und eigene didaktische Einheiten zu verfassen.
Was passiert mit den Ergebnissen?
Die Materialien werden von uns redigiert und online als PDF-Dokumente angeboten. Die didaktischen Einheiten werden dabei unter der CC-BY-SA Lizenz veröffentlicht. Die präsentierten Originaldokumente sind stets auch online verfügbar.
«Mein Brief ist lang geworden» – Zschokke transkribieren
Heinrich Zschokke (1771–1848) war einer der bedeutendsten Vordenker der modernen Schweiz. In unserem Bestand befinden sich 260 Briefe von und an Zschokke, die wir digitalisiert und auf e-manuscripta.ch veröffentlicht haben.
Anlässlich seines 250. Geburtstages wurden die Briefe im Transkriptionstool von e-manuscripta.ch transkribiert und ediert. Für einige Briefe lagen bereits unpublizierte Transkriptionen vor, die es auf die Plattform zu übertragen galt. Bei den anderen waren Lesekünste gefordert.
In zwei Workshops vor Ort präsentierten wird Originaldokumente zu Zschokke und führten die Citizen Scientists in die Funktionsweise des Transkriptionstools ein. Den grössten Teil der Transkriptionen erstellten die Citizen Scientists zwischen Mai 2021 und März 2022 online von zu Hause aus.
Was passierte mit den Ergebnissen?
Diese Arbeiten von 18 Citizen Scientists sind nun online auf der Plattform e-manuscripta.ch publiziert.