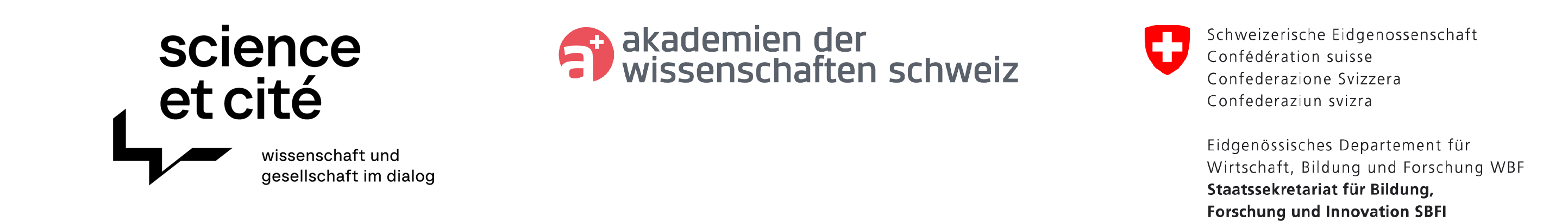Chronische Schmerzen im Kindes- und Jugendalter: Was kann die Forschung tun?
Kennst du Schmerzen, die andauernd da sind? Hast du Fragen dazu, auf die du bisher keine Antworten findest? Dann mach mit und erstelle mit anderen zusammen eine Forschungsagenda!
Worum geht es in dem Projekt konkret?
Kinder und Jugendliche sind häufig von chronischen Schmerzen betroffen, das heisst von Schmerzen, die während mindestens dreier Monate andauern oder wiederkehren. Chronische Schmerzen haben viele negative Begleiterscheinungen, wie beispielsweise Schlafprobleme, verpasste Schultage, Schwierigkeiten im sozialen Bereich und eine verringerte Lebensqualität.
Neue Forschungsergebnisse sollten daher möglichst rasch und verständlich an Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachpersonen weitergegeben werden - das ist aber oft nicht der Fall. Ein Grund dafür ist, dass Kinder und Jugendliche nicht in Forschungsprozesse einbezogen werden und auch nicht mitbestimmen können, welche Fragen beforscht werden sollen.
Wie können Bürger:innen mitforschen?
In unserem Projekt stehen Jugendliche mit chronischen Schmerzen und ihre Eltern im Zentrum: Wir wollen von ihnen wissen, (1) was sie selbst über chronische Schmerzen wissen wollen, um damit umzugehen respektive ihr Kind gut zu unterstützen, und (2) was das Umfeld (wie z.B. Freund:innen, Lehrpersonen, etc.) über chronische Schmerzen wissen soll, um betroffene Jugendliche bestmöglich zu unterstützen. Dazu haben wir mit Jugendlichen Diskussionsrunden durchgeführt, die nun analysiert werden. Eine Diskussionsrunde mit Eltern von Kindern oder Jugendlichen mit chronischen Schmerzen ist in Planung. Alle, deren Kind an Schmerzen leidet, können daran teilnehmen, die Diskussionsrunde findet virtuell statt und dauert etwa 90 Minuten.
Was passiert mit den Ergebnissen?
Wie die Ergebnisse kommuniziert werden, ist Teil des Forschungsprojekts. Alle Teilnehmenden werden nach Abschluss der Studie informiert - wie genau wird innerhalb des Projekts festgelegt.
Medizin im Dorf
Gemeinsam sammeln wir Medizingeschichte(n) aus Graubünden.
Worum geht es in dem Projekt?
Zur Geschichte der institutionellen medizinischen Versorgung und zur klinischen Medizin wurde in den letzten Jahren einiges publiziert. Noch wenig wissen wir über die Veränderungen der medizinischen Versorgung in den letzten Jahrzehnten in Graubünden. Das Wissen dazu lagert in den Köpfen der einheimischen Bevölkerung. Es sind eigene Erinnerungen sowie Geschichten und Traditionen, die weitererzählt und in der Familie weitergegeben werden. Damit dieses Wissen nicht verloren geht, tragen wir die vielfältigen Erfahrungen zusammen und ordnen sie historisch ein.
Medizinische Versorgung beinhaltet die klinische Medizin wie auch die unter dem Sammelbegriff der Komplementärmedizin zusammengefassten Formen und die sogenannte Volksmedizin.
Wer kann mitforschen und wie?
In Projekt «Medizin im Dorf» setzen wir gemeinsam mit der Bevölkerung Schwerpunkte und «Geschichtsdetektivinnen» und «Geschichtsdetektive» können selbst Interviews führen und damit Inhalte aktiv mitgestalten. Die Interviews werden aufgenommen. Alle Co-Forschenden haben eine Interviewschulung erhalten und die Handhabung der Aufnahmegeräte sowie Interviewtechniken geübt.
Was passiert mit den Resultaten?
2023 sind wir im Bündner Oberland in Kooperation mit dem Museum Regiunal Surselva gestartet. Seit Anfang 2025 sind die ersten Ergebnisse auf der Webseite www.medizin-im-dorf.ch zugänglich. Neben den Interviews geben Hintergrundtexte, Bilder und Geschichten Einblick in die Geschichte der medizinischen Versorgung im Dorf. Die Webseite wächst weiter und das Projekt «Medizin im Dorf» geht auch ins Oberengadin. Wir sind zudem auf der Suche nach «Rezepten und ihren Geschichten» aus dem gesamten Kanton, die online eingereicht werden können.
 Projekttreffen Medizin im Dorf, Foto: Geschichtspunkte GmbH
Projekttreffen Medizin im Dorf, Foto: Geschichtspunkte GmbH
HealthFerm – Die Karte der Schweizer Sauerteigkulturen
Wussten Sie, dass Ihr Sauerteig mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unikat ist? Logisch wussten Sie das.
Wir möchten es aber genau wissen, damit wir die Forschung an pflanzenbasierten, fermentierten Lebensmitteln vorantreiben und die Umstellung auf eine vermehrt pflanzlich basierte Ernährung ermöglichen können.
Dazu sind wir auf Ihre Mitwirkung angewiesen
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes HealthFerm, an dem die Universität Zürich und die ETH beteiligt sind, dokumentieren wir die grosse Vielfalt an Sauerteigkulturen in der ganzen Schweiz. Dazu können alle Sauerteigprofis – ob beruflich oder nicht – zwei Fragebogen zu ihrem Sauerteig ausfüllen oder diesen sogar zur mikrobiologischen Analyse einschicken.
Mehr Informationen zur Teilnahme finden Sie hier
Projekthintergrund
Fermentierte Lebensmittel sind sowohl in unserer täglichen Ernährung als auch in verschiedenen Esskulturen präsent: von (Sauerteig-)Brot über Bier, Wein, Essiggurken, Sauerkraut, Miso, Kombucha und vielem mehr. Die Kunst des Fermentierens ist auf dem Vormarsch, und viele Menschen stellen ihre eigenen fermentierten Lebensmittel zu Hause her. Die Fermentationstechnologie könnte uns bei der Umstellung auf eine vermehrt pflanzlich basierte Ernährung helfen. Das europäische Forschungsprojekt HealthFerm will die Zusammenhänge zwischen den an der Lebensmittelfermentation beteiligten Mikroorganismen, den aus diesen Prozessen resultierenden fermentierten Lebensmitteln und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit untersuchen. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt das Forschungsteam von HealthFerm Unterstützung von Mitbürgern, die bereit sind, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Projektteilnehmer werden gebeten, anhand von zwei Fragebögen Informationen über ihre Fermentationspraktiken und ihre Einstellung zu fermentierten Lebensmitteln mitzuteilen. Anhand von diesen Rückmeldungen werden die Forscher bis zu 1’000 Teilnehmer auswählen, die ihre fermentierten Lebensmittel zur Analyse einsenden können, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Sauerteig liegt.
Je nach geografischem Standort können die Teilnehmer*innen ihre Proben an fünf verschiedene Partner in ganz Europa senden: ETH Zürich (Schweiz), Institut für Biologie Bukarest (Rumänien), Universität Bozen (Italien), Universität Helsinki (Finnland) und Vrije Universiteit Brussel (Belgien). Die ETH Zürich und die KU Leuven (Belgien) werden das Forschungsprojekt koordinieren. Die Universität Umeå (Schweden) und die Universität Kopenhagen (Dänemark) werden die Erkenntnisse nutzen, um die wissenschaftliche Gemeinschaft und die politischen Entscheidungsträger zu informieren, was erforderlich ist, um den Übergang zu einer vermehrt pflanzenbasierten Ernährung bestmöglich zu fördern und zu unterstützen.
Die aus den eingesendeten, fermentierten Lebensmitteln gewonnenen Mikroorganismen werden zur Entwicklung innovativer Fermentationen von Hülsenfrüchten und Lebensmitteln auf Getreidebasis genutzt. Des Weiteren werden die gesundheitlichen Auswirkungen und die Verbraucherwahrnehmung neuartiger fermentierter Lebensmittel untersucht. Die Daten zu den Mikroorganismen, dem Genom und den Stoffwechselprodukten, die in den fermentierten Lebensmitteln der teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger entdeckt wurden, werden in einem frei zugänglichen Online-Atlas des Lebensmittelmikrobioms verfügbar sein. Dort können die Teilnehmer die Mikroorganismen aus ihren fermentierten Lebensmitteln bewerten und vergleichen.
Mit uns. Über uns. Patientennarrative als Co-Produktion – ein Beitrag zur Forschung über Partizipation.
Das Projekt «Patient*innennarrative als Ko-Produktion» forscht zum Thema partizipative Forschung. Es versteht sich als Pilotprojekt, das sich mit Erfahrungen und Wirkungsweisen von Partizipation befasst. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie unterschiedliche Formen von Partizipation den Forschungs- und Vermittlungsprozess in Bezug auf das individuell Krankheitserleben und die damit verbundenen Erfahrungen mit der Gesundheitsversorgung verändern.
Ausgangslage des Projekts bildet das 2017 gegründete Projekt DIPEx Schweiz, das Erfahrungen von Betroffenen zwischen Gesundheit und Krankheit in Form von narrativen Interviews aufzeichnet, mittels einer Datenbank qualitativ auswertet und in Ausschnitten (Video und/oder Audiodateien) ab Frühjahr 2021 auf einer Website für die Öffentlichkeit zugänglich macht. Projektpartner in diesem Vorhaben ist das Schweizer Projekt DIPEx.ch des Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte.
DIPEx (‘Database of Individual Patients’ Experiences’) wurde 2001 in Oxford als Pionierprojekt der direkten Patientenbeteiligung entwickelt, bei dem Betroffene mit ihren Erfahrungen als Expert*innen im Zentrum stehen und durch die Publikation eine öffentliche Stimme erhielten (www.dipexinternational.org). Seither haben sich die internationale Partizipationsforschung und die Möglichkeiten von Teilhabe, aber auch die Nutzergewohnheiten durch die Digitalisierung (Web 2.0/ Social Media) stark verändert.
Unser Projekt greift diese Veränderungen auf und geht der Frage nach, ob und wie das partizipative Potenzial des bisherigen Forschungs- und Vermittlungsprozess von DIPEx durch einen höheren Grad an Teilhabe von Betroffenen und Nutzenden erweitert und besser ausgeschöpft werden kann. Anhand aufeinander aufbauender Workshops reflektieren wir die vorliegenden Erfahrungen in Bezug auf den bisherigen Forschungs- und Vermittlungsprozess und erweitern die bisherigen Beteiligungsmöglichkeiten der Teilnehmer*innen durch erfahrungsbasiertes Co-Design mit Betroffenen und Nutzenden.
- Wie kann Partizipation mit oder durch die Zielgruppe neu gedacht und angereichert werden?
- Welche neuen Perspektiven auf die Potenziale von Partizipation in qualitativen Forschungsprozessen werden dadurch eröffnet?
- Wie können diese Erkenntnisse für die (digitale) Vermittlung von Forschungsresultaten und damit für die Gesundheitsversorgung und die Betroffenen nutzbar gemacht werden?
Mit der Metaperspektive auf Partizipation wollen wir in diesem Pilotprojekt eine Lücke im Dialog zwischen den Forschenden, Bürger*innen und Vermittlungs-Expert*innen näher beleuchten und zur Sprache bringen.
Projektteam Forschung
Schweizer MS Register
In der Schweiz leben rund 18‘000 Menschen mit Multipler Sklerose, kurz MS (Stand Januar 2024). Dies ist ein Anstieg von 20% im Vergleich zur letzten Schätzung aus dem Jahr 2019. Wie bewältigen MS-Betroffene ihren Alltag? Mit welchen Herausforderungen und Hürden werden sie täglich konfrontiert? Und welche Gesundheitsversorgung und Behandlungen nehmen sie in Anspruch?
CoronaReport
Ein Projekt der Scottish Collaboration for Public Health Research and Policy (SCPHRP) und der University of Edinburgh. Erfasse Deine Erfahrungen mit der Krankheit, sowie ihre Auswirkungen auf Dein Leben. Die App ist nicht als Software für Notfälle, oder für diagnostische / medizinische Zwecke gedacht.
Pilzfinder
Pilzfinder - darum geht es
Noch bis vor wenigen Jahrzehnten war die Kenntnis wildwachsender Speise- und Giftpilze weit verbreitet. Vor allem in der älteren Bevölkerung wusste man über das jahreszeitliche Auftreten der Pilze Bescheid. Pilzesuchen ist ein beliebtes Hobby bei Alt und Jung, das mit großer Erfahrung einhergeht. Um dieses Wissen zu erhalten, zu erweitern und vor allem auch der jungen Generation näher zu bringen, gibt es jetzt den Pilzfinder. Durch die Klimaerwärmung der letzten Jahre verschiebt sich auch zunehmend das Pilzvorkommen und das Artenspektrum. Von den Folgen der Klimaerwärmung sind besonders höhere Lagen betroffen. Viele Pilzarten haben Ausbreitungs- und Anpassungsstrategien, um auf Klimaveränderungen zu reagieren, ein unmittelbares Gefährdungsrisiko besteht jedoch in Hinblick auf die arktisch-alpin verbreiteten Pilzarten. Funddaten von Pilzen aus verschiedenen Ländern Europas zeigen, dass die Erscheinungszeit der Fruchtkörper in Folge der Klimaerwärmung zunimmt, also Pilze heute im Jahresverlauf über einen längeren Zeitraum auftreten. Auch verschiebt sich häufig die Erscheinungszeit nach weiter hinten im Jahresverlauf. Durch die aktive Mithilfe im Pilzfinder sollen diese Veränderungen der Pilzwelt jetzt erfasst werden können und in wissenschaftliche Auswertungen einfließen. Denn Pilze reagieren unmittelbar auf die wörtlich verrückte Temperaturentwicklung.
Im Rahmen dieses Projektes erheben Citizen Scientists pilzfloristische und phänologische Daten. Über Pilzfinder werden die wissenschaftlich fundierten Daten in die Datenbank der Pilze Österreichs der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft beim jeweils nächsten update übernommen. Das Projekt Pilzfinder hat zum Ziel, das Vorkommen und die Verbreitung der Pilze in Österreich und darüber hinaus umfassend zu dokumentieren und die verfügbaren Daten darzustellen und auszuwerten. Beim Vergleich der Verbreitungsdaten können Zusammenhänge zwischen Temperaturverlauf und Auftreten der Pilzarten erforscht und so Auswirkungen der Klimaänderung analysiert werden.
Mit dem Pilzfinder könnt ihr durch Beobachten und Fotografieren aktiv zur Erhebung des Vorkommens und der Verbreitung der Pilze beitragen. Auf Anfrage stellen wir für nichtkommerzielle Zwecke Meldungen gern zur Verfügung, natürlich auch für die Melder_innen selber. Alle wissenschaftlichen Ergebnisse werden in open Access/und peer-reviewed Journalen veröffentlicht. Es wird auch einen jährlichen Bericht über die Meldungen in den Mitteilungen der Österr. Mykolog. Ges. geben. https://www.univie.ac.at/oemykges/publikationen/mitteilungen-der-oesterr-mykolog-gesellschaft/
Interaktive Karte:
Bildergallerie
(zum Vergrößern der Fotos bitte auf das jeweilige Bild klicken)
-
 Weißstieliges Stockschwämmchen
Weißstieliges Stockschwämmchen
Weißstieliges Stockschwämmchen
Weißstieliges Stockschwämmchen
-
 Spindelfüßiger Champignon
Spindelfüßiger Champignon
Spindelfüßiger Champignon
Spindelfüßiger Champignon
-
 Grüner Speisetäubling (links, essbar), Grüner Knollenblätterpilz (rechts, tödlich giftig)
Grüner Speisetäubling (links, essbar), Grüner Knollenblätterpilz (rechts, tödlich giftig)
Grüner Speisetäubling (links, essbar), Grüner Knollenblätterpilz (rechts, tödlich giftig)
Grüner Speisetäubling (links, essbar), Grüner Knollenblätterpilz (rechts, tödlich giftig)
-
 Microbotryum pustulatum, Brandpilz auf Knöterich
Microbotryum pustulatum, Brandpilz auf Knöterich
Microbotryum pustulatum, Brandpilz auf Knöterich
Microbotryum pustulatum, Brandpilz auf Knöterich
-
 Simsen-Sklerotienbecherchen
Simsen-Sklerotienbecherchen
Simsen-Sklerotienbecherchen
Simsen-Sklerotienbecherchen
-
 Fenchelporling
Fenchelporling
Fenchelporling
Fenchelporling
-
 Speisetäubling
Speisetäubling
Speisetäubling
Speisetäubling
-
 Breitblättrige Glucke
Breitblättrige Glucke
Breitblättrige Glucke
Breitblättrige Glucke
-
 Fliegenpilz
Fliegenpilz
Fliegenpilz
Fliegenpilz
-
 Schweinsohr
Schweinsohr
Schweinsohr
Schweinsohr
-
 Zottige Tramete
Zottige Tramete
Zottige Tramete
Zottige Tramete
-
 Speisemorchel
Speisemorchel
Speisemorchel
Speisemorchel
-
 Feuerschwamm
Feuerschwamm
Feuerschwamm
Feuerschwamm
-
 Getigerter Knäueling
Getigerter Knäueling
Getigerter Knäueling
Getigerter Knäueling
-
 Getreide-Schwarzrost
Getreide-Schwarzrost
Getreide-Schwarzrost
Getreide-Schwarzrost
-
 Stockschwämmchen
Stockschwämmchen
Stockschwämmchen
Stockschwämmchen
-
 Neoerysiphe galeopsidis, Echter Mehltau auf Taubnessel
Neoerysiphe galeopsidis, Echter Mehltau auf Taubnessel
Neoerysiphe galeopsidis, Echter Mehltau auf Taubnessel
Neoerysiphe galeopsidis, Echter Mehltau auf Taubnessel
-
 Winter-Stielbovist
Winter-Stielbovist
Winter-Stielbovist
Winter-Stielbovist
-
 Violettfleischiger Laubholz-Becherling
Violettfleischiger Laubholz-Becherling
Violettfleischiger Laubholz-Becherling
Violettfleischiger Laubholz-Becherling
-
 Flächiges Buchen-Eckenscheibchen
Flächiges Buchen-Eckenscheibchen
Flächiges Buchen-Eckenscheibchen
Flächiges Buchen-Eckenscheibchen
-
 Rotrandiger Baumschwamm
Rotrandiger Baumschwamm
Rotrandiger Baumschwamm
Rotrandiger Baumschwamm
-
 Ockerrötlicher Resupinatstacheling
Ockerrötlicher Resupinatstacheling
Ockerrötlicher Resupinatstacheling
Ockerrötlicher Resupinatstacheling
-
 Grünblättriger Schwefelkopf
Grünblättriger Schwefelkopf
Grünblättriger Schwefelkopf
Grünblättriger Schwefelkopf
-
 Nelkenschwindling
Nelkenschwindling
Nelkenschwindling
Nelkenschwindling
https://www.schweizforscht.ch/voranbringen/arbeitsgruppen/kontextanalyse/tag/gesundheit#sigProIdc8c058c4a9
Reden Sie mit!
Medizinscher Fortschritt braucht innovative Ideen: Ihr Wissen ist wertvoll!
Wer weiß am besten, wie sich Arbeits-, Verkehrs- oder Sportverletzungen untersuchen und behandeln lassen? Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft startet „Reden Sie mit!“ um Fragen zu Unfallverletzungen in die Forschung zu bringen!
Fast jeder erleidet im Laufe seines Lebens einmal die ein oder andere Freizeitverletzung beim Sport, während der Arbeit oder bei einem Verkehrsunfall. Bei „Reden Sie mit!“ geht es darum, dass wir nach Forschungsfragen zu Unfallverletzungen suchen. Unser Ziel ist, Ihre Fragen in die Forschung zu bringen.
Wir wollen BürgerInnen und Bürger deshalb in die Forschung einbinden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir dadurch innovative Forschung anstoßen können.
Über einen Zeitraum von 8 Wochen können ab 8. Mai unter https://tell-us.online/de Forschungsfragen eingereicht werden.
Wie kann man mitmachen?
Die Teilnahme ist online — sie dauert 10 Minuten. Sie können auf Englisch oder auf Deutsch ihre Frage(n) einreichen. Das Ganze passiert über unsere Plattform https://tell-us.online/de
Braucht man dazu Vorwissen?
Nein, man braucht kein Vorwissen. Man braucht keine Erfahrung in der Forschung. Wir denken sogar, dass das ein Vorteil sein kann! Alles was man braucht ist eine oder mehrere Fragen zu Unfallverletzungen und 10 Minuten Zeit.
Was passiert mit den Ergebnissen?
Die Ergebnisse werden von uns zuerst gesammelt und danach systematisch analysiert. Wir werden alle eingereichten Forschungsfragen anonymisiert über OpenKnowledgeMaps visualisieren. Damit können Forscherinnen und Forscher aus dem Bereich Unfallverletzungen aus der ganzen Welt darauf zugreifen und diese Forschungsfragen in ihre Forschung einarbeiten.
Dieser Prozess wird sehr transparent erfolgen und wir wollen — wenn erwünscht — die IdeengeberInnen einbinden. Das ist uns sehr wichtig!
Wozu trägt die Forschung bei?
Unser Zugang, Forschungsfragen aus den praktischen Erfahrungen von Patientinnen und Patienten zu sammeln und systematisch in die Forschung zu bringen, ist im medizinischen Bereich einzigartig. „Reden Sie mit!“ trägt dazu bei, dass klinisches Wissen besser in die Forschung fließt und damit die Diagnose, Behandlung und Rehabilitation nach Unfällen verbessert werden kann.
Einen Blick hinter die Kulissen dieses Projektes bekommen Sie auch im Science Interview mit Eva mit dem Projektleiter Benjamin Missbach.
Swiss Expert Group for Citizen Science - Porträt:
-
Tiina Stämpfli
Chair of the Swiss Expert Group for Citizen Science
Science et Cité, Schweiz forscht / tous scientifiques, Linkedin
The project makes it possible to approach Citizen Science on a national level for the first time and I find it important and exciting to value different experiences, expertise and expectations and to learn together in order to further develop the landscape.
-
Tizian Zumthurm
Coordinator of the Swiss Expert Group for Citizen Science
Science et Cité, Schweiz forscht / tous scientifiques
I am delighted to coordinate the collaborative efforts of the expert group to expand the potentials and limits of Citizen Science and to contribute to fresh and important ways of participatory knowledge production.
-
Jan Freihardt
Wissenschaf(f)t Zukünfte e.V. and ETH Zürich, Linkedin
The concepts of Citizen Science can help science become truly transformative – actively engaging in and catalyzing societal change. To leverage this potential, we need to reflect critically on strengths and challenges associated with the different forms of Citizen Science – this is what we will do in this project for the context of Switzerland.
-
Sandra Gloor
The cooperation of citizen scientists and scientists is a win-win situation. In urban ecology, more data can be collected, also in areas that are not accessible to scientists. In return, citizen scientists receive information about their environment and contribute to science. Together, scientists and volunteers work to raise awareness of urban ecology issues and promote urban nature.
-
Olivia Höhener
UZH - Participatory Science Academy, Linkedin
Citizen Science in Switzerland has many different faces and facettes. It is important to see this diversity as a strength, not as a weakness. The project does exactly that: Value different experiences and expertise, put them in relation to each other and strengthen them altogether.
-
Alain Kaufmann
University of Lausanne: The ColLaboratory, Linkedin
Citizen science is an important issue for the democratization of research for universities and society. It is one of the ways to better respond to the needs of social actors to participate in the production of knowledge, and to contribute to the orientation of scientific work.
-
Pasqualina Perrig-Chiello
Citizen Science is an increasingly important complement to basic research. It has the potential to improve openness for new issues and research methods. In addition, the stronger connection between scientists and citizens ensures a better consideration of current relevant societal problems.
-
Jürg Pfister
Swiss Academy of Sciences, Linkedin
Citizen Science is very valuable to complement traditional research approaches and thus to expand our horizon by the joining forces of society and the sciences.
-
Maria Rosa (Rosy) Mondardini
Citizen Science Center Zurich, Linkedin
In this era of profound transformations, I believe Citizen Science can significantly help the global effort toward a more sustainable world. Switzerland is in a unique position to trailblaze meaningful public engagement, and radically democratize science both inside and outside academia.
-
Delphine Roulet Schwab
Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Linkedin
Citizen science allows us to acquire new knowledge and to develop concrete solutions that are rooted in the reality of the people concerned and that meet real needs.
-
Michael Stauffacher
ETH Zurich-tdlab, Twitter, Linkedin
Giving society the opportunity to contribute to science is key to raising awareness of how science works and building trusting relationships. It also helps science to include non-certified expertise that is so important for addressing complex societal challenges.
-
François Grey