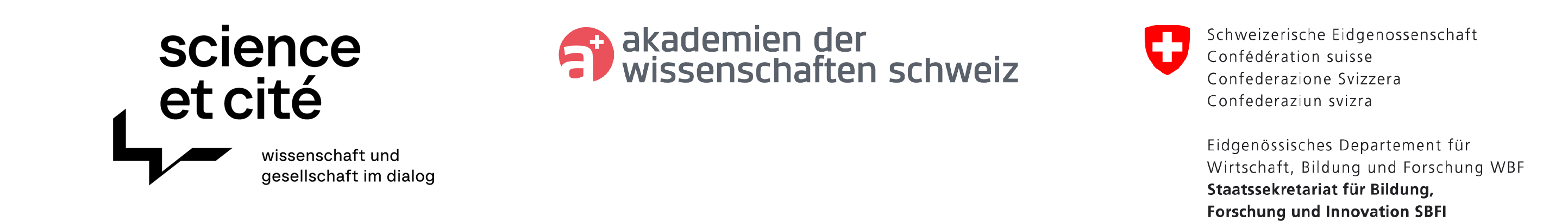KI wird in der Forschung vor allem dann gebraucht, wenn Daten zu komplex oder zu umfangreich für menschliche Herangehensweisen sind. Zu viele oder zu komplexe Daten ist eine häufige wissenschaftliche Motivation hinter vielen (kontributiven) Citizen-Science-Projekten. Da ist es naheliegend, dass viele davon versuchen, KI und Citizen Science zu verbinden. Auch bei eher kollaborativen Projekten gibt es vielversprechende Methoden, um KI sinnvoll einzusetzen.
Potenziell kann KI nicht nur die Datenverarbeitung beschleunigen und die zu verarbeitende Datenmenge erhöhen. Sie kann auch die zeitliche und geografische Reichweite von Projekten erhöhen und neue Datenquellen erschliessen. Zudem kann KI die Beteiligungsmöglichkeiten erweitern, zum Beispiel indem sie Lerninteraktionen zwischen Menschen und Maschinen erleichtern oder motivierend eingesetzt wird.
KI macht die Vorarbeit
Die vielleicht häufigste Aufgabe, welche KI in Citizen-Science-Projekten übernimmt, ist, spezifische Objekte – Tiere, Pflanzen, Wörter – in Bildern oder Texten zu finden. Menschen intervenieren dann, wenn die KI ungenau klassifiziert oder unbekannten Szenarien begegnet, zum Beispiel bei seltenen Spezies oder solchen, die sich ähneln. Diese sogenannten «Human-in-the-Loop» Strategien sind vor allem bei grossen Datenmengen sinnvoll, brauchen aber eine KI, die lernt, welche Bilder menschliche Intervention erfordern (siehe unten). Wie das konkret funktionieren kann, und wo Stärken und Schwächen in der automatisierten Bilderkennung liegen, haben unsere Kolleg:innen von catta getestet. Hier geht’s zu ihrem Bericht.
Zahlreiche Citizen-Science-Projekte aus der ganzen Welt und in der Schweiz haben schon erfolgreich mit Human in the Loop Ansätzen gearbeitet. Drei Beispiele:
Snapshot Safari: Teilnehmende sehen Bilder durch, um afrikanische Säugetierarten zu identifizieren und deren Verbreitung zu verstehen. Fotofallen an verschiedenen Standorten liefern jährlich Millionen von Bildern. Das Projekt trainierte die KI so, dass sie die häufigsten Spezies erkennt. Zur Identifizierung von seltenen oder zur Unterscheidung von ähnlichen Arten braucht es aber Citizen Scientists.
Galaxy Zoo: Weird & Wonderful: In diesem Projekt wurde eine KI darauf trainiert, Anomalien auf Teleskopaufnahmen zu entdecken. Citizen Scientists sind aber immer noch nötig, um klarer herauszuarbeiten, welche Bilder denn wirklich potentiell interessante Objekte enthalten oder um Bildartefakte herauszufiltern.
ZB Zürich Transkriptionen: Dank der grossen Fortschritte in der automatisierten Handschriftenerkennung, übernehmen Citizen Scientists in diesem Projekt das Transkribieren alter Texte nicht mehr gänzlich selbst. Sie fungieren eher als Korrigierende der KI. So können beispielsweise Namen und Orte schneller identifiziert werden.
KI analysiert Daten
Zahlreiche Citizen-Science-Plattformen wie iNaturalist, SciStarter oder Zooniverse bieten schön länger KI zur Datenanalyse an. Es ist aber oft sinnvoll, ein neues Programm zu erstellen oder ein bestehendes anzupassen, um den Bedürfnissen des eigenen Projekts gerecht zu werden. Auch in diesem Bereich gibt es bereits zahlreiche Beispiele aus den unterschiedlichsten Disziplinen.
Science Scribbler: Virus Factory: Citizen Scientists markierten und klassifizierten Viren aus einer Bildserie. Dabei mussten sie nur noch einige Punkte setzen, statt genaue Umrisse zu zeichnen. Aus dieser Arbeit konnte eine dafür trainierte KI die Viren zählen und erkennen. Diese Methode spart Zeit und zeigt, wie Menschen und Maschinen gemeinsam komplexe Forschungsfragen lösen können.
Leben mit Multipler Sklerose: MS-Betroffene erzählen über ihre Erfahrungen mit der Krankheit. Mit dem sogenannten «Topic Modelling» arbeitet eine KI aus Texten oder Interviewaufnahmen die zentralen Themen und Aussagen aus. Das spart nicht nur Zeit, sondern kann auch neue Erkenntnisse liefern und überraschende Zusammenhänge aufzeigen.
KI trainieren
Ein wachsendes Feld für Citizen-Science-Projekte ist, dass Teilnehmende selbst KI trainieren. Dies können sie einerseits tun, indem sie fehlende Daten liefern. Andererseits können sie auch fehlende Perspektiven liefern. Das soll soziale Vorurteile abbauen, die sich oftmals in KI-Programmen finden und macht sie so inklusiver. Grundsätzlich braucht KI genug offene Daten, damit man sie trainieren kann. Das macht sie für manche Disziplinen (z.B. Biomedizin) eher schwierig zugänglich.
Wie Citizen Scientists zur Entwicklung von KI beitragen, zeigt beispielsweise, das GLOBE Observer Programm, welches auch in der Schweiz aktiv ist. Hier können Citizen Scientists Fotos zu Wolken, Baumhöhen, Landbedeckung und vielen anderen Dingen erfassen. Mit hochgeladenen Bildern von Moskitolarven wurde eine bestehende KI entscheidend weiterentwickelt: Die vorhandenen Aufnahmen stammen zumeist aus dem Labor. Citizen- Science-Fotos aus dem Feld mit teils ungünstigen Lichtverhältnissen und aufgenommen mit Laienkameras haben die Erkennungsfähigkeiten stark verbessert.
Mit KI lernen
Des Weiteren wird KI in Citizen-Science-Projekten zunehmend dafür eingesetzt, um die Teilnehmenden zum Mitmachen und Lernen zu motivieren. Aus der Schweiz nutzt zum Beispiel das Projekt solarpionier.ch ein Chatbot, um erste Fragen zu stellen und Informationen zu liefern.
Gemäss einer Studie mit Projekten auf Galaxy Zoo arbeiten die meisten Teilnehmenden lieber mit KI-generierten Motivationsbotschaften als ohne. Gravity Spy gilt diesbezüglich als gelungenes Beispiel: Hier führt eine KI die Teilnehmenden durch zunehmend komplexere Aufgaben, um so kontinuierlich ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu steigern.
Es kann aber auch das Gegenteil passieren: Die Aufgaben werden dank KI zu simpel oder zu komplex, um für Citizen Scientists attraktiv zu sein. Dies ist eine der grössten Herausforderungen beim Forschungsdesign. Hier gilt es, eine gute Balance zu finden, welche natürlich vor allem vom übergeordneten Ziel des Projekts abhängt.
Bereits heute ist KI sehr häufig auf produktive Weise in Citizen Science integriert. Es bestehen zwar einige Herausforderungen und Fallstricke, die nicht zu unterschätzen sind und besonders in Bezug auf Diversitätstraining und lokaler Anpassung gibt es noch einiges zu tun. Die hier aufgeführten Projekte zeigen, dass KI bedeutend mehr kann als nur halbwegs originelle Einleitungssätze zu schreiben.
Dieses Spotlight basiert auf der Collection The Future of Artificial Intelligence and Citizen Scienc des Journals «Citizen Science : Theory and Practice» (9/1 2024).