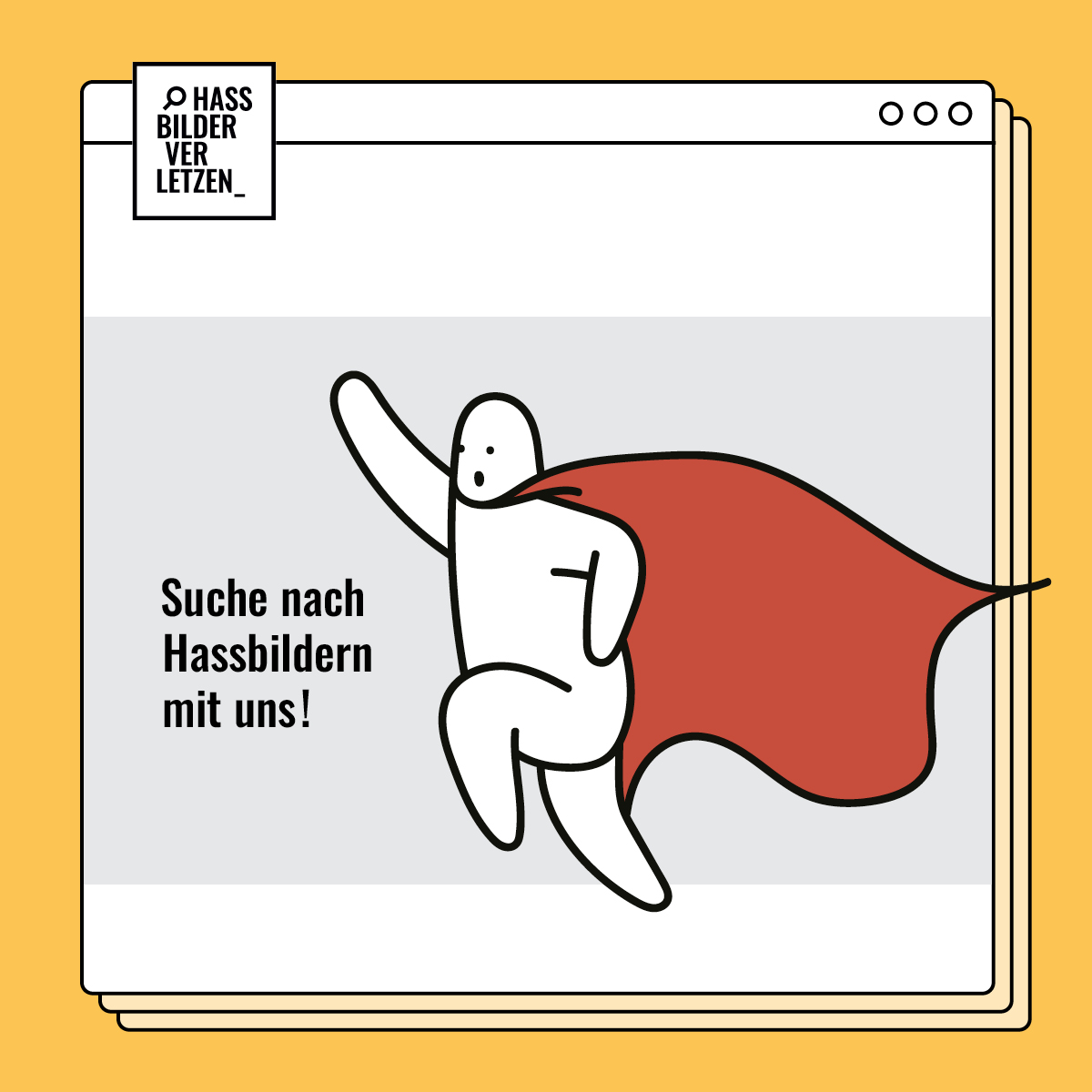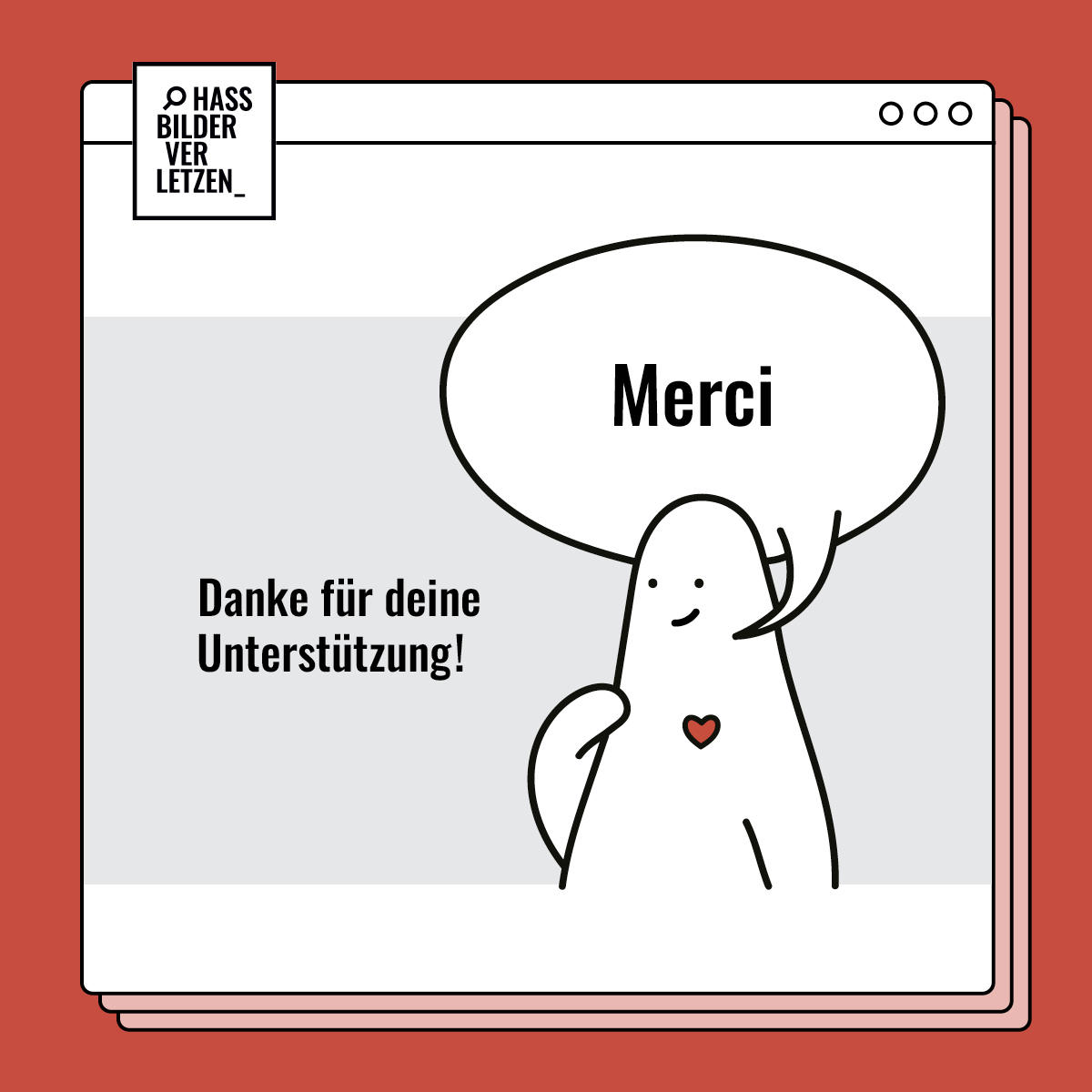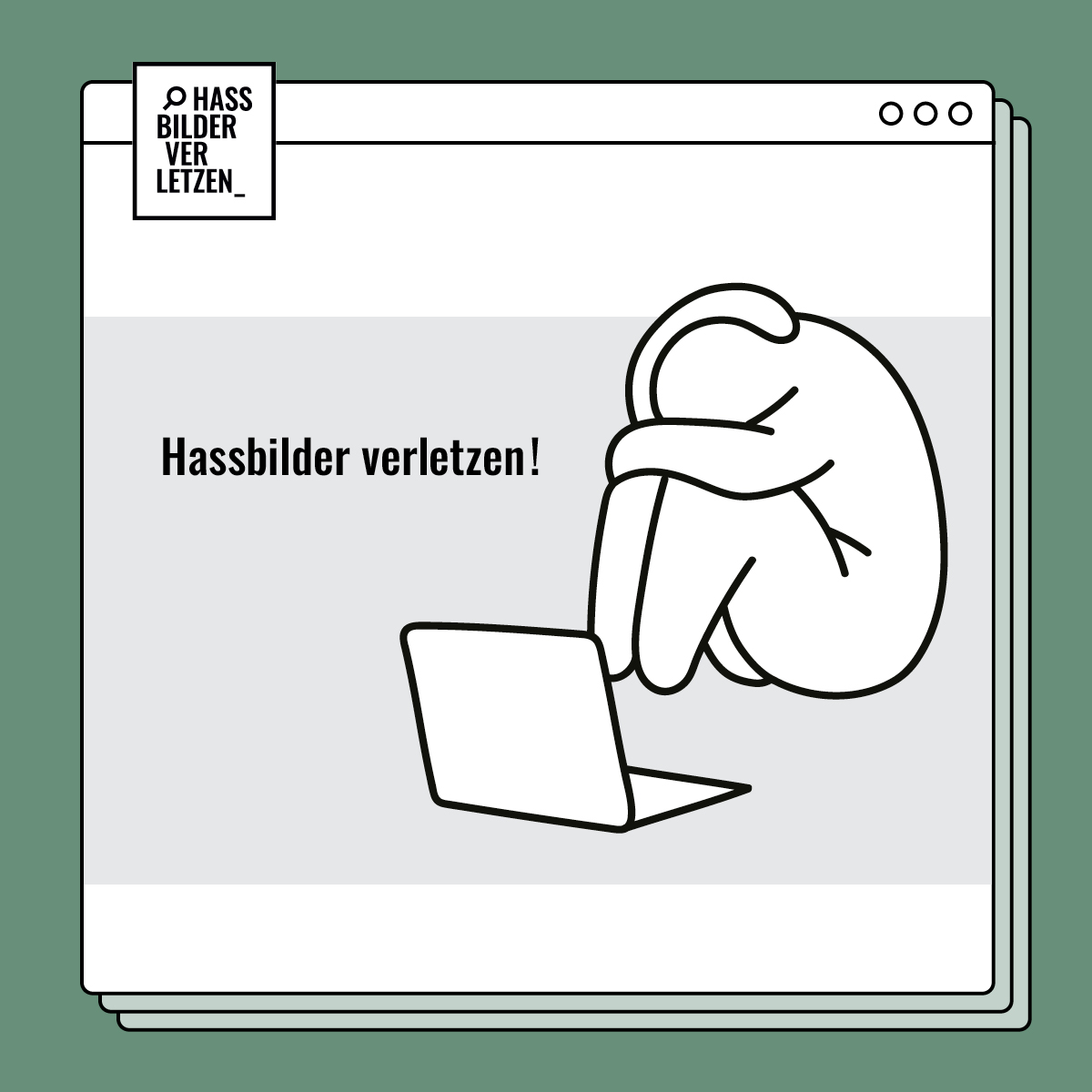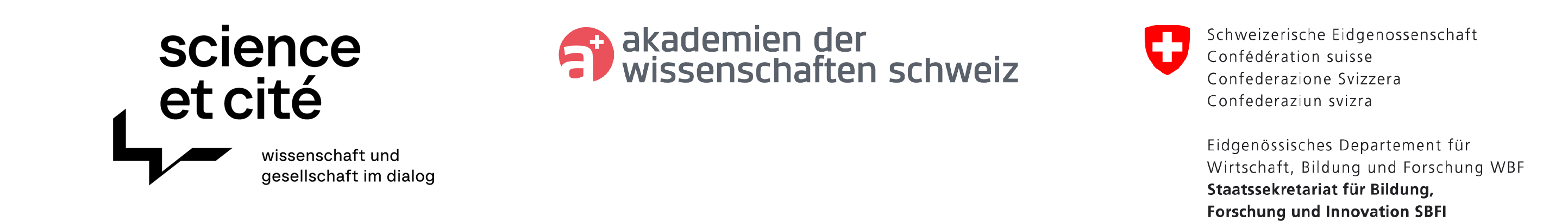Öffentlichkeiten der Kunst. Die Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung
Dies ist ein Blogbeitrag in der Serie «Best Practice Wissenschaftskommunikation»
Autorin: Yvonne Schweizer
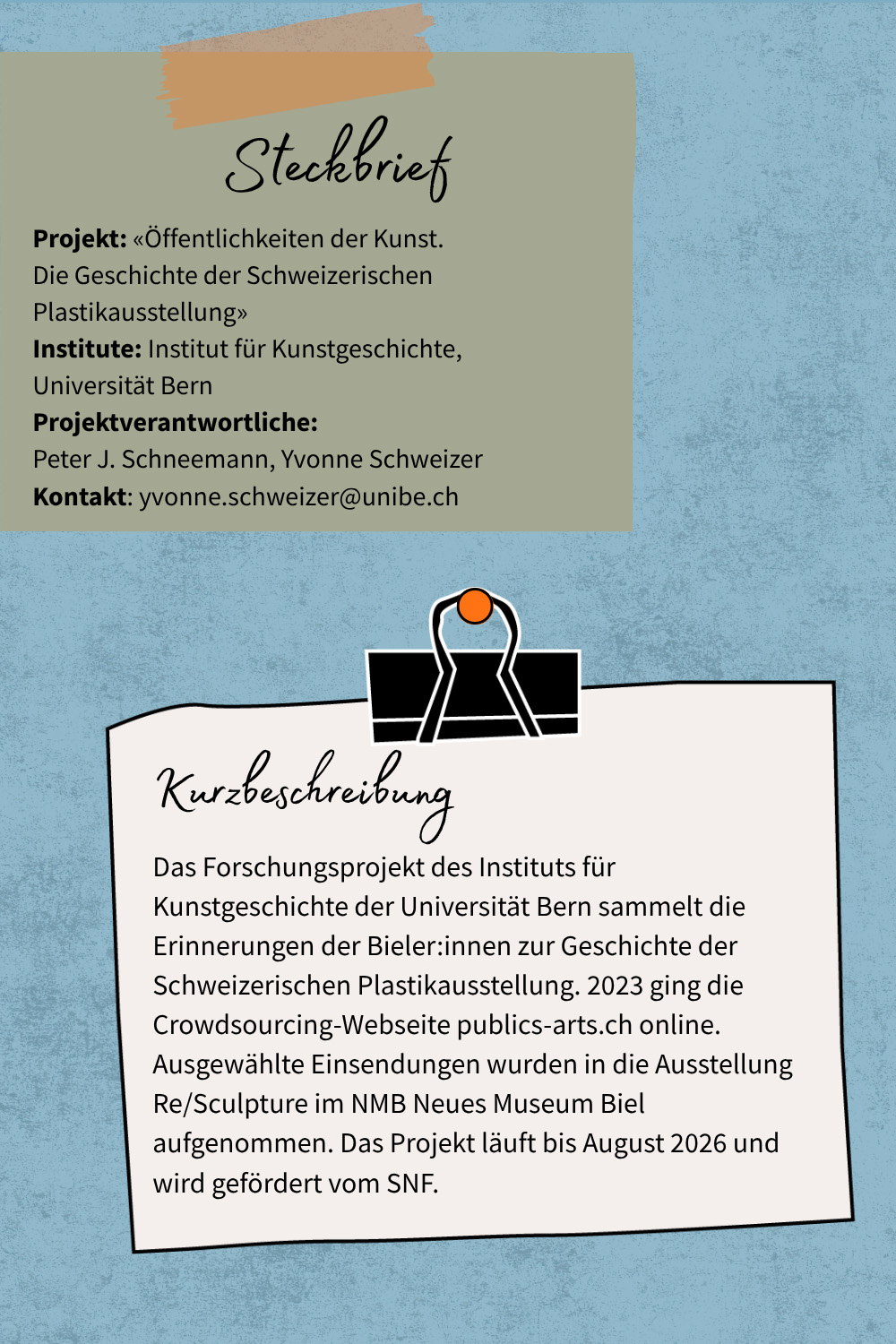 Das Forschungsprojekt des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Bern sammelt die Erinnerungen der Bieler:innen zur Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung. 2023 ging die Crowdsourcing-Webseite publics-arts.ch online. Ausgewählte Einsendungen wurden in die Ausstellung Re/Sculpture im NMB Neues Museum Biel aufgenommen. Das Projekt läuft bis August 2026 und wird gefördert vom SNF.
Das Forschungsprojekt des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Bern sammelt die Erinnerungen der Bieler:innen zur Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung. 2023 ging die Crowdsourcing-Webseite publics-arts.ch online. Ausgewählte Einsendungen wurden in die Ausstellung Re/Sculpture im NMB Neues Museum Biel aufgenommen. Das Projekt läuft bis August 2026 und wird gefördert vom SNF.
Crowdsourcing in den Geisteswissenschaften
Welche Nutzungen und Umnutzungen finden an Kunst im öffentlichen Raum statt? Wie kann eine Ausstellung zu Skulptur im öffentlichen Raum aus der Sicht des Publikums erzählt werden? Diese Fragen beschäftigen ein Forschungsteam von Kunsthistoriker:innen der Universität Bern, das dafür das partizipative Citizen Archive publics-arts.ch gestartet hat. Anlass dazu gibt ein Forschungsprojekt zur Schweizerischen Plastikausstellung, der grössten und ältesten Ausstellungsreihe zur Skulptur im öffentlichen Raum. Sie findet seit 1954 in regelmässigen Abständen im Freien in Biel/Bienne statt.
Die Webseite richtet sich an die Bieler Zivilgesellschaft, die in mehreren aufeinander aufbauenden Medienkampagnen und Kulturanlässen dazu aufgerufen wurde, ihre Erinnerungen an die Geschichte der Schweizerischen Plastikausstellung zu teilen. Hochgeladen werden können alle Dateiformate: Fotografien, Texte, Audiobeiträge, Zeitungsausschnitte, Filme – alles, was sich in privaten Alben und Kisten auf dem Estrich finden lässt.
Partnerin des Projekts ist das NMB Neues Museum Biel unter der Leitung von Bernadette Walter, mit deren Team 2024 die Retrospektive Re/Sculpture zu 70 Jahren Schweizerische Plastikausstellung umgesetzt wurde (Abb. 1). Ausgewählte Einsendungen aus dem Citizen Archive waren in die Ausstellung integriert. Sie erhielten Sichtbarkeit über die Webseite hinaus. Einzelne Zusendungen beeinflussten die Ausrichtung der Themenschwerpunkte von Re/Sculpture. So machte uns Annelise Zwez per Audiobeitrag mit ihren Thesen zum Gender Gap der Ausstellungsreihe vertraut. Ihr Beitrag war schliesslich in der Ausstellung zu hören. Auf diese Weise ist die Stadtbevölkerung in die Geschichtsschreibung eingebunden. Citizen Science wird somit unter dem Aspekt eines Co-Designs von Wissenschaft verstanden.
Im Folgenden werden die einzelnen Projektetappen mit den jeweiligen Kommunikationsstrategien vorgestellt.
Von der Idee...
Ziel des Forschungsprojekts ist die erstmalige Bearbeitung des Archivs der ältesten und bedeutendsten Ausstellungsreihe zur Skulptur im öffentlichen Raum der Schweiz. Über die mehrmonatige Laufzeit ist die Schweizerische Plastikausstellung besonders niedrigschwellig zugänglich, denn sie findet traditionell nicht in Kunstinstitutionen, sondern auf offener Strasse und mitten im Stadtzentrum statt. Entsprechend ist ihr Publikum besonders divers: von interessierten Kunstbesucher:innen über zufällig Hineingeratende bis hin zu begeisterten Fans oder empörten Mitbürger:innen. Jede:r Bieler:in entwickelt eine starke Meinung zur jeweiligen Ausgabe. Viele brachten sich in der Vergangenheit in die Umsetzung selbst mit ein, so dass die Ausstellungsreihe auch ein wichtiger Faktor des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der vielsprachigen Stadt Biel/Bienne geworden ist. Besonders deutlich zeigte sich das zivilgesellschaftliche Potential anlässlich Thomas Hirschhorns Robert Walser-Sculpture auf dem Bahnhofsplatz, der bis dato letzten Ausgabe der Schweizerischen Plastikausstellung. Über den Sommer 2019 hatten der Künstler, lokale Vereine, Initiativen sowie die Bieler:innen gemeinsam einen Begegnungsort im Freien errichtet.
Erste Stichproben im Archiv zeigten, dass zahlreiche administrative Unterlagen erhalten waren – darunter Rechnungen, Sitzungsprotokolle, Zeitungsausschnitte, der Briefverkehr mit Künstler:innen sowie Auftragsfotografien der Ausstellung. Wie sich jedoch das Publikum gegenüber der Ausstellungsreihe äußerte, welche Perspektive Besuchende einnahmen und welche Eindrücke sie fotografisch festhielten, ergab sich in den meisten Fällen nicht aus dem offiziellen Archiv zur Ausstellung. Deshalb war im Forschungsdesign ein Citizen Science-Teilprojekt vorgesehen, für dessen Umsetzung Ressourcen bei Förderinstitutionen angefragt und gesprochen wurden. Für die Programmierung der Webseite kooperierte das Forschungsteam mit Tobias Hodel, Professor und Leiter des Bereichs Digital Humanities an der Universität Bern.
...Zur Umsetzung
Mai 2023
Der Startschuss fiel mit der Aufschaltung der Crowdsourcing-Webseite publics-arts.ch.
Verbunden war der Launch mit einer aufwändigen Medienkampagne, die von der Universität Bern und der Stiftung Schweizerische Plastikausstellung mitgetragen wurde. Die Medienmitteilung zirkulierte via Twitter und konnte Berichterstattung beim SRF Kulturradio erzielen (Abb. 2). Das Forschungsteam war an zwei Sonntagen auf dem Bahnhofsplatz in Biel mit einer Selfie-Installation präsent und sprach Laufpublikum auf seine Erinnerungen an die Schweizerische Plastikausstellung an (Abb. 3). Der Anlass war in das Rahmenprogramm der Bieler Fototage eingebettet. Im Gespräch wurden Postkarten mit einem QR-Code zur Webseite verteilt. Das Projekt wurde auf der Webseite schweiz-forscht.ch gelistet . Es gab einen direkten Zusammenhang mit den Kommunikationsmassnahmen: Es liess sich beobachten, dass insbesondere die Berichterstattung in den klassischen Print- und Radiomedien Resonanz erzeugten. So kamen bis heute (Stand Mai 2025) rund 420 Beiträge zusammen.
Oktober 2023
Das Forschungsteam richtete im NMB den Anlass Bring Your Own Story im Zusammenhang mit dem UNESCO-Welttag des audiovisuellen Erbes und in Kooperation mit dem überregionalen Verein memoriav aus (Abb. 4). Im Foyer des Museums befand sich eine Scan-Station für Dias sowie eine Audiostation zur Aufnahme von Oral History-Beiträgen. In lokalen Zeitungsberichten war am Tag des Anlasses dazu aufgerufen worden, mit persönlichen Erinnerungsstücken ins Museum zu kommen . Rund zehn Personen kamen an diesem Nachmittag mit ihren privaten Fotosammlungen und Geschichten vorbei – da mit der Abgabe ein hoher Rechercheaufwand verbunden ist, darf die Anzahl Beitragende als Erfolg verbucht werden.
Per Postwurfsendung erhielten alle Haushalte Biel/Biennes Werbepostkarten mit dem QR-Code zur Webseite.
August 2024
Die Ausstellung Re/Sculpture. Die Schweizerischen Plastikausstellungen Biel eröffnete im NMB mit einem grossen Fest, zu dem alle Beitragenden eingeladen waren. Ins Museum kamen an diesem Tag 250 Gäste (Abb. 5).
In der Retrospektive waren rund 600 Objekte und Dokumente zu sehen. Museum- und Forschungsteam verantworteten die Kuration gemeinsam – in der Umsetzung wurden die Zusendungen der partizipativen Webseite berücksichtigt.
Das Ausstellungskonzept stellte zwei Lesarten gegenüber (Abb. 6):
- eine chronologische, die sich an den Fundstücken aus dem offiziellen Stiftungsarchiv orientierte;
- eine thematische, für die sich das Kuratorinnen-Team wesentlich auf die Zusendungen des Crowdsourcings stützte.
Partizipative Displays sollten für ein Update der Ausstellung während der Laufzeit sorgen. So waren die Besuchenden aufgefordert, Erinnerungsstücke an die Schweizerische Plastikausstellung in einer dafür vorgesehenen Vitrine zu deponieren. Eine Fotowand konnte um eigene Porträts ergänzt werden. Die Ausstellung schloss mit dem Verweis auf die Crowdsourcing-Webseite und die Bitte, digitale Souvenirs einzureichen – im Vergleich zu den Anlässen, die zu persönlicher Begegnung einluden, zeigte das jedoch leider keine direkte Wirkung.
Das Rahmenprogramm der Ausstellung umfasste zahlreiche partizipative Anlässe, zu denen die Erinnerungen des Publikums an die Ausstellungsreihe geteilt werden konnten: Partizipative Stadtrundgänge (Abb. 7), künstlerische Performances und Filmscreenings zu Biels Skulpturen im öffentlichen Raum, Workshops für Kinder und Jugendliche sowie die Wiederholung des Anlasses „Bring Your Own Story“.
Von Risiken...
Es zeigten sich im Laufe des Projekts spezifische Anforderungen, die nicht im Voraus planbar waren und besonders den Kunstbereich betreffen. Zum einen gilt bei fotografischen Zusendungen ein Schutz durch das Urheberrecht. Alle auf publics-arts.ch veröffentlichten Fotografien mussten vom Team geprüft werden und gegebenenfalls das Veröffentlichungsrecht bei den Künstler:innen oder deren Vertretungsberechtigten eingeholt werden. Es kam allerdings nur in Einzelfällen vor, dass dem Projektteam eine Veröffentlichung versagt blieb.
Zweitens setzt eine Kuration mit partizipativem Anteil Planung, aber auch Flexibilität in der Ausstellungsplanung voraus. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor in der Planung der Ausstellung war etwa, wie viele Crowdsourcing-Einsendungen berücksichtigt werden können. De facto erreichten das Team bis kurz vor Ausstellungsbeginn Erinnerungsstücke und das Organisationsteam musste flexibel reagieren.
Drittens zeigte die Beteiligung an den partizipativen Displays besonders dann einen Effekt, wenn sie in Verbindung mit Anlässen im Rahmenprogramm standen oder aufgrund von persönlichem Austausch angeregt wurden.
...Und Erkenntnissen
Wer Citizen Science betreibt, erhält in der Regel ein direktes Feedback zur eigenen Forschung, gerade wenn Anlässe zum persönlichen Austausch einladen. Daraus zog das Forschungsteam grosse Motivation. Unbedingt zu empfehlen ist es, von Anfang an mit bestehenden Netzwerken und Initiativen vor Ort Kooperationen zu suchen. Die Anlässe im Rahmen von lokalen Kooperationen zeigten denn auch besonders signifikante Wirkung, insbesondere wenn damit eine Berichterstattung in Printmedien und Radio verbunden war.
Crowdsourcing zu Objekten ist mit einem Aufwand für die Citizen Scientists verbunden: Zusätzlich zum Rechercheaufwand müssen analoge Fotografien, Dias und Filme erst digitalisiert werden, bevor sie hochgeladen werden können. Aus unserer Erfahrung empfiehlt es sich, den Digitalisierungsschritt an Scan-Tagen anzubieten und den Citizen Scientists auf diese Weise ein digitalisiertes «Souvenir» zurückzugeben.
Veröffentlicht am 18. Juni 2025.
 Abb. 1: NMB Biel/Bienne, Ausstellung Re/Sculpture © Yvonne Schweizer
Abb. 1: NMB Biel/Bienne, Ausstellung Re/Sculpture © Yvonne Schweizer Student:innen und Senior:innen forschen gemeinsam zur Geschichte der Fremdplatzierung
In der Schweiz wurden allein im 20. Jahrhundert mehrere Hunderttausend Kinder und Jugendliche fremdplatziert, d.h., sie durften nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, sondern sind in Heimen oder Pflegefamilien untergebracht worden. In dem Citizen-Science-Projekt «Was war bekannt?» haben Wissenschaftler:innen und Bürger:innen durch Zeitungsanalysen gemeinsam herausgefunden, was die Öffentlichkeit über die Lebensverhältnisse der fremdplatzierten Minderjährigen wissen konnte. Die zentralen Ergebnisse der Studie sind auf der Projektwebsite und in einem Magazin zusammengefasst.
|
Dr. Michèle Hofmann ist Leiterin der Forschungsstelle Historische und vergleichende Kindheits- und Jugendforschung am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich. Sie hat das Citizen-Science-Projekt «Was war bekannt?» gemeinsam mit Prof. Dr. Franziska Oehmer-Pedrazzi (Fachhochschule Graubünden) und Dr. Philipp Hubmann geleitet. |
|
Das Projekt
Am Anfang des Projekts stand die Idee, interessierten Bürger:innen verschiedener Altersstufen Einblicke in wissenschaftliches Arbeiten und das Thema Fremdplatzierung zu geben und sie darüber in Austausch zu bringen. Das Ziel war es, gemeinsam eine Antwort auf die Frage zu finden, wie Fremdplatzierung im Mediendiskurs der Schweiz im 20. Jahrhundert verhandelt wurde. Die unterschiedlichen (Lebens-)Erfahrungen der Co-Forschenden sollten als wichtiger Bezugsrahmen bei der Diskussion und Analyse von Quellenfunden dienen.
Bürgerforscher:innen finden
Die Projektleitenden versuchten auf verschiedenen Wegen, Bürgerforscher:innen zu finden, die an dem Projekt mitarbeiten wollten. Dafür richteten sie einen Instagram-Kanal ein, produzierten ein Trailer-Video, versandten einen Aufruf per E-Mail und verteilten Flyer. Wichtig war, dass die Geschäftsstelle der Senior:innen-Universität Zürich den Aufruf zur Mitarbeit an ihre Mitglieder weiterleitete (der Versand musste vorgängig beantragt und bewilligt werden). Durch diesen Aufruf konnten mehrere sehr engagierte Bürgerforscher:innen für das Projekt gewonnen werden. Diese haben für die Website und das Magazin Beiträge zur Geschichte der Fremdplatzierung verfasst, auf Instagram über das Projekt gepostet und ausserdem ihre Erfahrungen mit Citizen Science geteilt: in einem schriftlichen Bericht auf der Projektwebsite und in einem Porträt für das Schweizer Forschungsmagazin «Horizonte».
Nebst den Senior:innen bildeten Student:innen eine zweite grössere Gruppe von Projektmitarbeiter:innen. Bachelor- und Masterstudierende des Instituts für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich besuchten im Rahmen des Projekts ein oder sogar zwei Forschungspraktika. Die Student:innen leisteten dabei nicht nur die durch die Praktika vorgegebenen Arbeitsstunden, sondern sie investierten viel mehr Zeit in das Forschungsprojekt, nahmen an den regelmässig stattfindenden Treffen teil und brachten ihre Ideen ein. Sie wurden so zu einem festen Bestandteil des Projektteams und damit zu eigentlichen Bürgerforscher:innen. Teil des Projektteams war auch eine im Masterstudiengang Bildungswissenschaften an der Universität Basel eingeschriebene Studentin. Alle studentischen Bürgerforscher:innen haben einen oder sogar mehrere Beiträge für die Projektwebsite und das Magazin geschrieben. Eine Studentin berichtete ausserdem in einem Video-Interview von ihren Erfahrungen mit Citizen Science.
Gemeinsame Zeitungsrecherche
Die Bürgerforscher:innen haben nach einer Einführung zum methodischen Vorgehen zwei überregionale und auflagenstarke Schweizer Tageszeitungen recherchiert: die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und die Berner Zeitung Der Bund. Gesucht wurden Zeitungsartikel, die einen Bezug zur Thematik der Fremdplatzierung aufweisen. Die grosse Menge an gedrucktem Papier verunmöglichte es, alle Ausgaben der beiden Zeitungen für das gesamte 20. Jahrhundert durchzusehen. Das Projekt konzentrierte sich deshalb auf einzelne Untersuchungszeiträume, die aufgrund von bestimmten Ereignissen, die für die Geschichte der Fremdplatzierung bedeutsam sind, als besonders vielversprechend schienen. Die NZZ wurden in der Zentralbibliothek Zürich im Original (Printausgaben) durchgeblättert und Der Bund auf der Online-Plattform E-Newspaper Archives durchgesehen. Beim Durchblättern der einzelnen Zeitungsausgaben war es das Ziel, in die Medienberichterstattung des 20. Jahrhunderts einzutauchen. Die Teilnehmer:innen sollten so einen konkreten Eindruck von dem historischen Kontext, in dem die Berichterstattung über Fremdplatzierung eingebettet war, erhalten. Die recherchierten Zeitungsartikel wurden in einer gemeinsamen Datenablage abgespeichert. Im Anschluss an die Recherche haben die Bürgerforscher:innen ausgewählte Zeitungsartikel analysiert und basierend auf ihrer Analyse Texte für die Website und das Magazin verfasst.
Generationenübergreifende Zusammenarbeit
Das Projektteam, bestehend aus den Citizen Scientists, den Projektleiter:innen und einer Supervisorin, hat sich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren regelmässig getroffen, um den Zwischenstand der Recherche zu diskutieren und die weiteren Schritte zu planen. Die Treffen und das Projekt insgesamt zeichneten sich durch eine sehr gelungene Zusammenarbeit von jungen und älteren Citizen Scientists aus. Die Projektleitenden hatten sich vom Einbezug von Bürger:innen verschiedener Altersstufen versprochen, dass deren unterschiedliche (Lebens-)Erfahrungen die Diskussion und Analyse von Quellenfunden bereichern würden. Und das war auch tatsächlich der Fall. Während den Älteren bestimmte Fremdplatzierungsmassnahmen wie etwa die «Verdingung» von Kindern und Jugendlichen auf Bauernhöfen, die bis in die frühen 1980er-Jahren Bestand hatte, oder auch die Debatten rund um die Auflösung des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse» in den 1970er-Jahren bestens bekannt waren, waren die Jüngeren damit weniger oder gar nicht vertraut. Die studentischen Bürgerforscher:innen konnten dafür ihr Wissen aus dem Studium in die Diskussionen einfliessen lassen. Der generationenübergreifende Austausch beschränkte sich nicht auf die Projekttreffen, einzelne Student:innen und Senior:innen bildeten auch Tandems und arbeiteten in dieser Konstellation themenspezifisch zusammen. Die generationenübergreifende Zusammenarbeit wurde nicht nur von den Beteiligten sehr geschätzt, sondern sie hat auch das Projekt und die Forschungsergebnisse bereichert.
Veröffentlicht am 29. April 2025.
Von Flyern bis Social Media: Wie eine Kommunikationskampagne Citizen Scientists für die Analyse von Hassbildern mobilisierte
Dies ist ein Blogbeitrag in der Serie «Best Practice Wissenschaftskommunikation»
Autor:innenteam: Franziska Oehmer-Pedrazzi & Stefano Pedrazzi
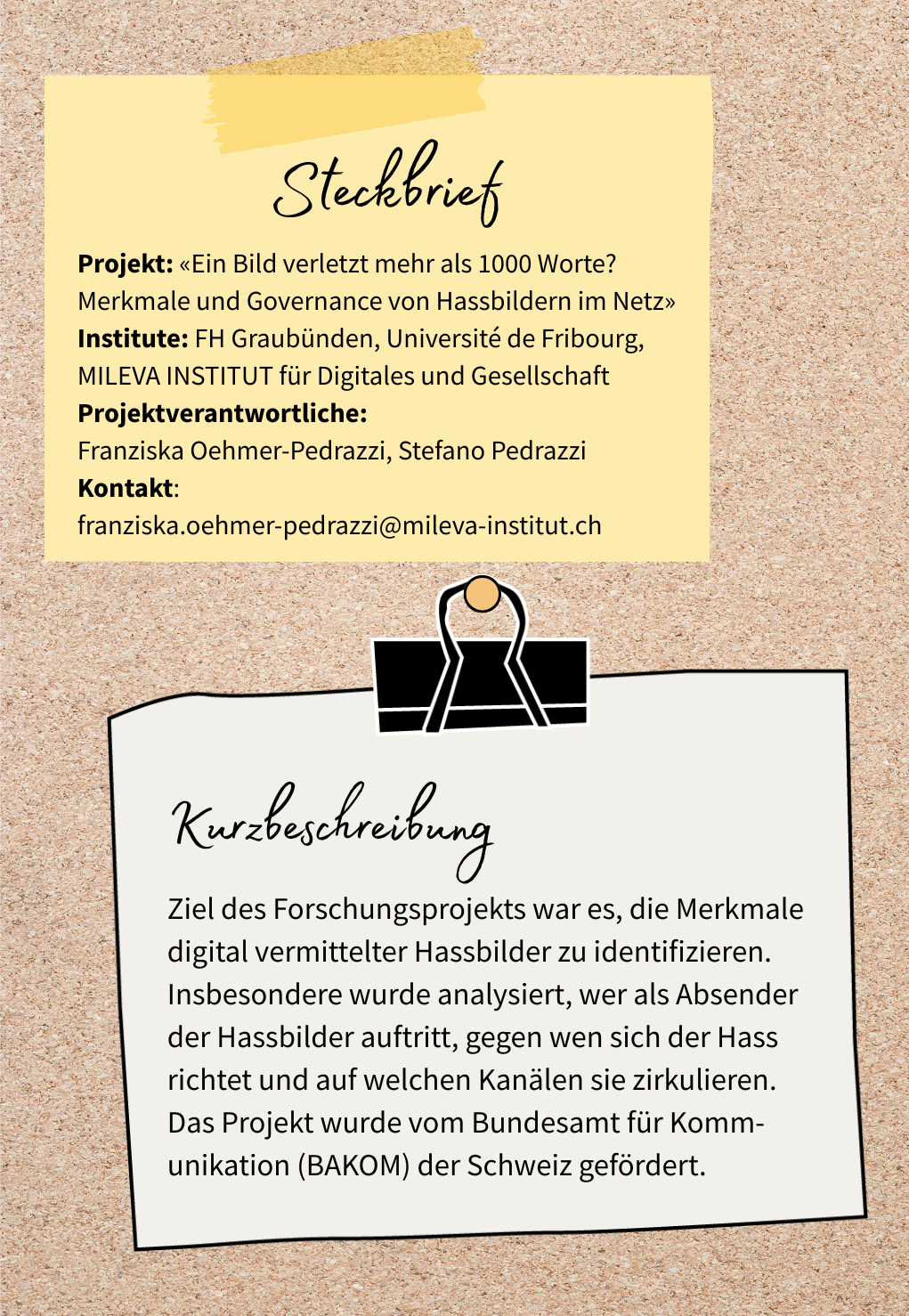 Visuelle Inhalte sind mächtige Werkzeuge der Kommunikation – sie können nicht nur informieren und unterhalten, sondern auch Hass schüren, gesellschaftliche Gruppen ausgrenzen oder Einzelpersonen diffamieren. Genau hier setzt das Forschungsprojekt «Ein Bild verletzt mehr als 1000 Worte? Merkmale und Governance von Hassbildern im Netz» an, das von der FH Graubünden, der Université de Fribourg und dem MILEVA INSTITUT für Digitales und Gesellschaft durchgeführt wurde.
Visuelle Inhalte sind mächtige Werkzeuge der Kommunikation – sie können nicht nur informieren und unterhalten, sondern auch Hass schüren, gesellschaftliche Gruppen ausgrenzen oder Einzelpersonen diffamieren. Genau hier setzt das Forschungsprojekt «Ein Bild verletzt mehr als 1000 Worte? Merkmale und Governance von Hassbildern im Netz» an, das von der FH Graubünden, der Université de Fribourg und dem MILEVA INSTITUT für Digitales und Gesellschaft durchgeführt wurde.
Ziel des Projekts war es, die Charakteristika digitaler Hassbilder zu identifizieren: Wer verbreitet diese Bilder? Gegen wen richten sie sich? Auf welchen Kanälen zirkulieren sie? Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Beteiligung von Citizen Scientists, die aktiv bei der Datensammlung und Interpretation der Hassbilder mitwirkten. Doch wie wurden diese Bürgerforschenden mobilisiert, und welche Kommunikationsstrategien erwiesen sich als besonders effektiv?
Rekrutierung der Citizen Scientists: Kommunikationsstrategien und Herausforderungen
Die Akquise von Citizen Scientists stellte sich als ressourcenintensive Aufgabe heraus. Um möglichst viele und heterogene Personen mit unterschiedlichem Mediennutzungsverhalten zu erreichen, wurde vom 3. Februar bis zum 3. März 2023 eine breit angelegte Kommunikationskampagne durchgeführt. Das gesamte Kampagnenmaterial wurde durch drei ansprechende Illustrationen von Aline Hafen visuell aufgewertet (siehe unten). Die abgebildeten Figuren wurden bewusst ohne menschliche Züge gestaltet, um geschlechtliche Zuschreibungen zu vermeiden. Jede Illustration verfolgte eine spezifische kommunikative Zielsetzung:
1. Sensibilisierung für die Problematik visueller Hassrede im digitalen Raum
2. Motivation zur Teilnahme am Projekt
3. Ausdruck des Dankes an die Teilnehmenden
Im Rahmen der Kampagne kamen verschiedene Kommunikationsinstrumente zum Einsatz:
|
Trotz der Vielfalt der Kommunikationswege blieb eine Herausforderung bestehen: Die Mehrheit der Citizen Scientists stammte aus akademisch geprägten und zivilgesellschaftlich engagierten Milieus. Ob dies auf generelles Interesse dieser Gruppen an Citizen Science, auf die spezifische Thematik oder auf eine unzureichende Reichweite der Kommunikationsstrategie zurückzuführen ist, bleibt eine offene Frage.
Beteiligung der Citizen Scientists
Um eine möglichst einfache Beteiligung zu gewährleisten, wurde die Einreichung von Hassbildern über eine eigens entwickelte Projektwebsite organisiert. Dabei konnten Nutzer:innen per Drag-and-Drop Bilder hochladen und im Anschluss Fragen zum Bild und ihrer eigenen Person beantworten.
Zur Unterstützung der Citizen Scientists wurden folgende Massnahmen umgesetzt:
- Eine verständlich formulierte Definition von Hassbildern auf der Website.
- Ein verpixeltes Beispielbild zur Orientierung.
- Pretests mit fünf Personen unterschiedlicher Alters- und Bildungshintergründe zur Optimierung der Nutzerfreundlichkeit.
Zur Rolle der Citizen Scientists
Das Projekt fand seinen Abschluss im Winter 2024. Die erzielten Erkenntnisse wurden sowohl in einer deutschsprachigen als auch in einer internationalen Publikation der Fachcommunity zugänglich gemacht. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Förderinstitution, dem Bundesamt für Kommunikation, präsentiert. Die Citizen Scientists waren dabei massgeblich an der Datensammlung und der Interpretation der Hassbilder beteiligt. Sie unterstützten aktiv bei der Identifizierung von Hassbildern: Sie wurden nicht nur gebeten, ein Hassbild einzureichen, sondern auch zu begründen, weshalb es sich um ein Hassbild handeln könnte. Dies führte zu einem breiteren Analyseansatz als in vielen bisherigen Studien: Während sich Forschung häufig auf einzelne Plattformen oder thematische Schwerpunkte beschränkt, ermöglichte der Citizen-Science-Ansatz eine weitreichendere Untersuchung. So konnten beispielsweise kommerzielle Kleinanzeigenplattformen als Verbreitungsorte von Hassbildern identifiziert werden – ein Aspekt, der in traditionellen Studien häufig unberücksichtigt bleibt.
Fazit
Insgesamt betrachtet erwies sich der Mix aus verschiedenen digitalen und analogen Kommunikationsinstrumenten von Social Media, über Medienmitteilungen bis hin zu Flyern als besonders zielführend. Auch die professionell gestalteten Kampagnenillustrationen stiessen auf positive Resonanz. Für Citizen-Science-Projekte empfiehlt es sich ein entsprechendes Budget mit zu veranschlagen.
Veröffentlicht am 16. April 2025.
Diese Illustrationen von Aline Hafen begleiteten die Kommunikationskampagne: