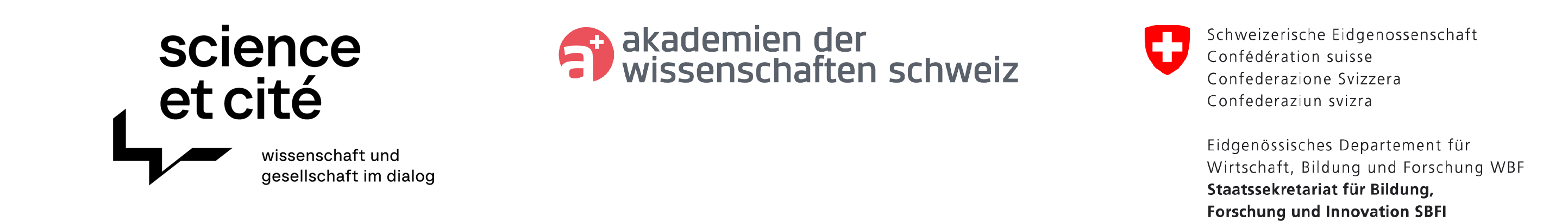Spüren Sie die asiatische Hornisse auf, handeln Sie mit uns!
Haben Sie ein gutes Auge, um eine Asiatische Hornisse zu erkennen? Kann Ihre Aufmerksamkeit den entscheidenden Unterschied für unsere Honigbienen und heimischen Insekten machen? Ist Ihr Blick scharf genug, um unsere Bienen zu schützen? Wir wissen nur sehr wenig über diese Hornissenart und werden mit der Hilfe vieler Menschen neue Erkenntnisse gewinnen. So ist beispielsweise nicht bekannt, auf welcher maximalen Höhe ein Nest in der Schweiz gefunden wurde. Die Art scheint sich auf städtische Gebiete zu konzentrieren. Aber liegt das an fehlenden Beobachtungen in ländlichen Gebieten oder an einer Präferenz der Hornisse?
Baumwanzen-Monitoring
Worum geht es in dem Projekt konkret?
Die marmorierte Baumwanze, Halyomorpha halys, wurde etwa um das Jahr 2000 aus China in die Schweiz eingeschleppt. Der älteste Nachweis stammt aus Zürich-Seefeld aus dem Jahr 2004. Von dort hat sich die Wanze über die gesamte Schweiz und Europa ausgebreitet. Die Wanzen sind bei ihrer Nahrung nicht wählerisch und fressen an über 300 Wirtspflanzen. Leider gehören auch viele unserer Obstsorten zu ihrem Speiseplan. Im Jahr 2019 kam es zu einer Massenvermehrung der Wanzen, die zu erheblichen Schäden im Obstanbau führte. In den letzten Jahren sind die Populationen jedoch wieder erheblich geschrumpft.
Mit dem Projekt möchten wir die aktuelle Ausbreitung und Häufigkeit der Wanzen innerhalb der Schweiz verfolgen. Jedes Jahr kommt es durch klimatische Faktoren zu grossen Schwankungen der Wanzenpopulationen, daher kann ein Monitoring helfen, die Entwicklung der Wanzenpopulationen besser zu verfolgen.
Wie können Bürger:innen mitforschen?
Wenn sie die Wanzen in ihrem Garten, ihrer Wohnung oder auf dem Balkon entdecken sollten, dann würden wir uns freuen, wenn sie ihren Fund auf der Seite https://www.halyomorphahalys.com/melden-sie-einen-fund-report-a-finding.html melden. Um ganz sicher zu sein, dass es sich um die gesuchte Wanze handelt, wäre es ideal, wenn sie auch ein Foto der Wanze mitschicken könnten.
Was passiert mit den Daten?
Aus den eingegangenen Arten wird eine aktuelle Verbreitungskarte der Wanzen erstellt, die auch darüber Auskunft geben kann, wo momentan besonders viele Wanzen auftreten. Da die Untersuchungen schon 2012 gestartet wurden, erhalten wir so auch ein gutes Bild der langfristigen Entwicklung der Wanzenpopulationen.
Überlebende Insekten am Licht
Darum geht es
Kunstlicht hat auf viele nachtaktive Insekten eine anziehende Wirkung. Im Aussenraum aufgestellte Verkaufsautomaten werden in der Schweiz von einer Firma dominiert und erzeugen daher vergleichbares Licht über das ganze Siedlungsgebiet verteilt.
Die Beleuchtung der Dächer dieser Automaten ist kaltweiss und das Licht zieht in der Nacht Insekten magisch an.
Sie stehen bevorzugt an Bahnhöfen oder Bushaltestellen bei Läden usw.
So kannst du mitforschen
Dark-Sky Switzerland möchte den Effekt an unterschiedliche Standorten mit Eurer Hilfe systematisch beobachten.
Leider gibt es nicht mehr überall genügend Insekten, dass man immer Insekten an den Leuchten finden kann.
Kein Insekt (also Null) gefunden ist daher auch ein wichtiges Resultat!
Die Anleitung findest du auf unserer Webseite.
Die Voraussetzungen für das Experiment sind diese:
- Genügend Körpergrösse oder ein kleiner Schemel um das Automaten-Dach von Hand zu erreichen.
- 1 weisses DIN A4 Blatt
- 1 Drucker für das PDF
- 1 Schere zum Ausschneiden
- kleines Gewicht (Stein, Schlüssel, Schokolade usw.)
- Klebeband für unten (wenn der Wind bläst)
- Wetter: warm genug (12°C oder mehr ist ideal), trocken genug (am besten nicht bewölkt oder kein Regen).
- Nacht genug: Neumond oder maximal Halbmond, mindestens 1/4 Stunde nach Sonnenuntergang.
- Standort: Du kennst schon einen Automaten, oder finde einen. Es macht nichts, wenn Du mehrere Abende messen willst oder jemand anders denselben Standort auswertet.
- Handy, Tablet usw. um Deine Auswertung mit Standort zu erfassen. Es geht auch zu Hause im Internet, wenn Du aufschreibst.
Jede Haftung wird abgelehnt.
Es gilt: Wenn Ihr alles Material wieder entfernt, begeht Ihr keine Sachbeschädigung und Ihr tut nichts Verbotenes.
Dennoch solltet Ihr auf Kund·inn·en Rücksicht nehmen, die etwas am Automaten kaufen wollen und Ihnen nicht im Weg stehen und Auskunft geben falls die sich wundern.
Das passiert mit den Ergebnissen
Deine Eingaben werden in einer Datenbank zwischengespeichert.
Aus der Summe der Eingaben wollen wir im besten Fall die Verteilung der Insekten über die Standorte abschätzen.
Wenn wir viele Eingaben haben, können wir vielleicht einen Vergleich zur allgemeinen Dunkelheit der Umgebung herstellen, ebenso wie vielleicht zu typischen Lebensräumen, wo die Insekten hergekommen sein können.
Wenn Ihr eure Kontaktdaten hinterlässt, werden wir Euch im Herbst nach der Auswertung die Resultate zukommen lassen.
Falls die Resultate Erkenntnisse generieren, streben wir eine Publikation an, wir werden Eure verwendeten Beiträge listen.
Aber die privaten Angaben sind freiwillig. Du kannst Resultate auch anonym einsenden.
Danke fürs Mitmachen
Liliana und Lukas
IPM Popillia
Das Ziel von IPM-Popillia ist es, die vom invasiven Japanischen Käfer (Popillia japoinica) ausgehende Gefahr für die Pflanzengesundheit in Europa abzuwenden. Dieser Schädling wurde 2014 versehentlich auf das europäische Festland eingeschleppt (EPPO 2014) und kann sich durch den Handelsverkehr sowie den Waren- und Personenverkehr leicht ausbreiten. P. japonica bedroht den gesamten Agrarsektor, Stadtlandschaften, sowie die Biodiversität in befallenen Gebieten.
Die Verhinderung der Invasion durch diese Art sieht sich mit zwei Herausforderungen konfrontieret: Einerseits ist die Möglichkeit den Waren- und Personenverkehr einzuschränken begrenzt, andererseits ist die erfolgreiche Ausrottung der südlich der italienisch-schweizerischen Grenze angesiedelten Population unmöglich.
Mit der IPM (Integrated Pest Management) Citizen Science App kannst du mithelfen, das Auftreten der invasiven Art Japankäfer zu melden und Orte im Agrarbereich wie Felder, Plantagen, Gemüseanbau oder auch im privaten Garten zu beobachten. Mit den Citizen Science Beiträgen unterstützt du aktiv unsere Chance, die Invasion des Japankäfers zu stoppen und die Sicherheit unserer Nahrungsproduktion in Europa, den USA und in der ganzen Welt zu erhöhen.
Vor Kurzem haben die EFSA und das JCR der Europäischen Kommission den P. japonica zum Schädling mit hoher Priorität im neuen EU-Pflanzengesundheitsgesetz nominiert. Deshalb ist es wichtig Maßnahmen zu entwickeln, die dabei helfen, die Ausbreitung des neuen Schädlings einzudämmen und den Aufbau hoher Populationsdichten zu verhindern, die zu wirtschaftlichen Verlusten für landwirtschaftliche Kulturen führen und den Migrationsdruck der Japanischen Käfer erhöhen.
Das Projekt IPM-Popillia entwickelt diese Maßnahmen. Es umfasst Teams, mitten im jüngsten Ausbruchsgebiet arbeiten und zweckdienliche praktische Forschung in einem europäischen Umfeld durchführen, die sofort als kurzfristige Eindämmungsmaßnahmen angewendet werden kann. Längerfristig bietet IPM-Popillia Werkzeuge und Ratschläge zur Bekämpfung des Schädlings in einem größeren europäischen kontinentalen Maßstab und zur besseren Vorbereitung auf ähnlichen Schädlingsbefall in der Zukunft.
Die interaktive App und die User Community laufen auf der Citizen Science App Plattform SPOTTERON und mit der Community auf www.spotteron.app.
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 861852
Webfauna
Webfauna ist das Online-Meldeportal von info fauna - CSCF & karch für alle Beobachtungen von Wildtieren in der Schweiz und im angrenzenden Ausland.
Asiatische Mörtelbiene
Wir suchen die Asiatische Mörtelbiene!