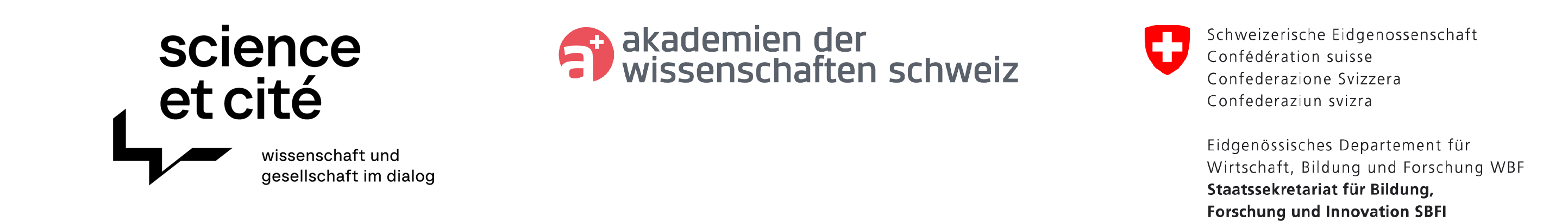In diesen drei Sätzen steckt bereits die gesamte Theorie aus unserem Netzwerktreffen zum Thema Storytelling. Astrid Tomczak-Plewka, Redaktionsmitglied vom Forschungsmagazin «Horizonte» und freischaffende Journalistin, brachte uns den Ansatz in Form der sogenannten Heldenreise näher. Diese Art eine Geschichte aufzubauen ist von der griechischen Mythologie bis Hollywood weit verbreitet und geht so: Ein:e Protagonist:in (unsere Gruppe von Forschenden) mit einem klaren Ziel (ihr Projekt als Geschichte) muss Hindernisse überwinden (die Frage, wie man eine gute Geschichte erzählt), um das Ziel zu erreichen (die Präsentation des Projekts am Netzwerktreffen).
Geschichten faszinieren uns. Das wurde schon beim Aufwärmen klar: Mit grossem Elan und viel Fantasie erzählten die Teilnehmenden eine je erfundene und wahre Geschichte (daher die Menschenaffen, Mailflut, Platanen und Elefanten aus der Einleitung). Wir wissen aus der Forschung, dass Geschichten neugierig machen, uns involvieren und emotional ansprechen. Und: Unser Gehirn verarbeitet Geschichten wie tatsächlich Erlebtes, weswegen sie auch hängen bleiben.
Die Heldenreise nach Joseph Campbell ist auch in der Wissenschaftskommunikation eine weit verbreitete Methode des Storytellings (siehe zum Beispiel der Gewinnertext vom Prix Média 2023: Wie drei heldenhafte Ärzte die Schweiz vom Kropf erlösten, evtl. gebührenpflichtiger Artikel). Die Heldenreise kann gut an Citizen-Science-Projekte angepasst werden. Held:innen gibt es genug: Forschende, Citizen Scientists, das Team. Das Ziel ist meistens klar durch die Forschungsfrage und die Aufgaben vorgegeben. Hindernisse, die es zu überwinden gilt, gibt es (leider) meistens auch mehr als genug: Die Abhängigkeit von äusseren Einflüssen, die Herausforderung eine gemeinsame Sprache zu finden, die Schwierigkeit Teilnehmende zu finden und Verbindlichkeit zu schaffen, und so weiter. Das Ziel wird dann meistens (hoffentlich) mit einem Erfolgserlebnis erreicht: Alle Beteiligten haben ihre Aufgabe gelöst und die Forschungsfrage ist geklärt.
Bei einer konkreten Umsetzung helfen für gutes Storytelling allgemeine Tipps aus der Wissenschaftskommunikation und dem Journalismus. Der Titel ist der Türöffner für eine gute Story. Es ist wichtig, dass er konkret ist; Abstraktes schreckt eher ab und ist unklar. Der Titel soll einerseits die Botschaft zusammenfassen und andererseits Neugierde wecken und Spannung aufbauen. Es kann dabei helfen, Fragen zu formulieren oder Wortspiele zu machen. In der Geschichte selbst lauern einige typische Stolperfallen: zahlreiche Fremdwörter sind unnötig, viele Details sind nur für Forschende interessant, zur Methodik genügen ein bis zwei Sätze.
So viel zu den formalen Empfehlungen. Aber was sind denn die inhaltlichen Elemente einer guten Wissenschaftsgeschichte? Tomczak-Plewka streicht hierfür die folgenden 7 Punkte heraus:
- Als Ausgangslage empfiehlt sich eine klare Fragestellung und/oder ein bestimmtes Thema.
- Eine interessante Prämisse – also eine faszinierende Ausgangslage oder ein unerwartetes Ergebnis – kann das Interesse des Publikums wecken.
- Protagonist:innen schaffen Nähe. In der Wissenschaft gibt es davon zuhauf: Forschende, Doktorierende, Dozierende oder Proband:innen. In Citizen-Science-Projekten kommen noch die Citizen Scientists als nahbare Held:innen dazu.
- Auch die Wissenschafts-Story lebt von Spannung und Konflikten. Das können gescheiterte Versuche, der Kampf um Ressourcen, Wettbewerbe oder ähnliches sein.
- Daten und Fakten sind wichtig. Dabei müssen sie natürlich korrekt sein und die Lesenden sollten die Informationen verstehen und überprüfen können.
- Kernaussage: Die Geschichte sollte eine klare Botschaft haben, die sich aus den Ergebnissen der Studie oder Forschung ergibt. Zum Beispiel: «Die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf der Covid-Erkrankung».
- Ein positives Ergebnis kommt immer gut an. Das ist beispielsweise der Fall, wenn die Geschichte zeigt, dass und wie die Forschung einen Beitrag zur Erweiterung des menschlichen Wissens oder zur Lösung eines bestimmten Problems geleistet hat.
Storytelling ist auch für Citizen Science eine exzellente Methode, um wissenschaftliche Prozesse und Fakten zu vermitteln und das Publikum auf verschiedenen Ebenen anzusprechen. Wer sein Citizen-Science-Projekt mit der bewährten Heldenreise erzählt, macht es nicht nur verständlicher, sondern auch einprägsamer.
Veröffentlicht am 1. Oktober 2025.